Das Studium der Zahnmedizin ist im Wesentlichen auf medizinische Themen fokussiert. Daher fehlt häufig nicht nur das Verständnis für Praxiskennzahlen, sondern auch die Kenntnis, welche Zahlen relevant und wo diese zu finden sind. Der Rat des Steuerbüros kann an dieser Stelle sicher hilfreich sein, reicht in der Regel aber nicht aus. Leider liefern auch die gängigen Praxisverwaltungssoftware-Systeme nicht automatisiert notwendige Daten, diese müssen vielmehr über diverse Filter aus der Software gefiltert werden. Schlussendlich stellt sich aber immer noch die Frage, welche Kennziffern relevant sind und wie sie interpretiert werden müssen.
Grobe wirtschaftliche Beurteilung der Praxis
Als Erstes hilft der Blick in die BWA vom Steuerberater, der alle Einnahmen und Ausgaben der Praxis „bucht“ und aus der Differenz den Gewinn vor Steuern ermittelt. Hier gilt grob die 2/3 zu 1/3 Regel, d.h. 2/3 der Einnahmen dürfen Kosten sein. Anschließend müssen die BWA-Kennzahlen mit Vergleichswerten abgeglichen werden, d.h. wo steht die Praxis im Wettbewerb zu anderen Praxen. Hier hilft als erste Orientierung der Blick in die von der KZBV veröffentlichen Zahlen über den Bundesdurchschnitt aller Praxen. Demnach erwirtschaftet eine Praxis im Durchschnitt 716.000 Euro Gesamteinnahmen; dieser Betrag setzt sich zusammen aus 475.700 Euro Gesamtkosten und 240.300 Euro Gewinn vor Steuern. Auf den einzelnen Inhaber runtergerechnet, lauten die Zahlen 605.100 Euro Gesamteinnahmen, 402.000 Euro Gesamtkosten und 203.100 Euro Gewinn. Dabei verteilen sich die Einnahmen in etwa je zur Hälfte aus KZV-Einnahmen und privaten Einnahmen. Bei den Kosten gilt der primäre Blick auf die Personalkosten, die immer den größten Kostenteil abbilden. Diese werden laut KZBV mit etwa 27% an den Einnahmen angegeben. Dies ist insbesondere nach Corona und dem aktuell überall spürbaren Fachkräftemangel in der Regel nicht mehr zu schaffen. Personalkosten bis zu maximal 35% sind daher durchaus realistischer und vertretbar. In einem ZMVZ müssen die Personalkosten für gewöhnlich anders betrachtet werden. Das liegt nicht an höheren Kosten, sondern der Gesellschaftsform (häufig als GmbH), in der die Praxis eingebunden ist. Die Zahlen werden in der Durchschnittspraxis mit ca. 600 GKV-Scheinen pro Quartal erreicht. Die PKV-Fallzahl weicht je nach Region stark ab und liegt in der Regel bei ca. 10% der GKV-Scheinzahlen.
Einnahmensituation im Detail
Bei genauerer Betrachtung können z.B. die Einnahmen und Kosten auf die Anzahl der Mitarbeiter/-innen aufgeteilt ermittelt werden. Dieser Wert ist insofern von großer Bedeutung, da er zeigt, wie rentabel die Praxis mit dem gesamten Mitarbeiterstab ist und wie schnell sich Rentabilitäten mit der Anstellung weiterer Mitarbeiter/-innen ohne zusätzliche Umsatzentwicklung verschlechtern. Die Durchschnittspraxis beschäftigt 7,3 Mitarbeiter/-innen und arbeitet in 3 Behandlungszimmern. Daraus ergeben sich im Durchschnitt ca. 65.000 Euro Kosten bzw. ca. 33.000 Euro Gewinn pro Mitarbeiter/-in. Würde die Durchschnittspraxis nur 1 Mitarbeiterin oder 1 Mitarbeiter mehr beschäftigen, reduziert sich der Gewinn schon auf ca. 29.000 Euro pro Mitarbeiter/-in. Bei den Einnahmen verhält es sich ähnlich. Die Einstellung 1 weiteren Mitarbeiters oder 1 weiteren Mitarbeiterin reduziert die Einnahmen pro Mitarbeiter/-in von ca. 98.000 Euro auf ca. 86.000 Euro und beeinflusst somit deutlich die Rentabilität der Praxis bzw. die Pro-Kopf-Einnahmen und letztendlich den Gewinn der Praxis.
Als Nächstes gilt es Folgendes zu ermitteln: Woher stammen die Einnahmen, mit welchen Leistungen bzw. von wem wurden sie erbracht, und welche üblichen Potenziale ergeben sich in Bezug auf die individuelle Patientenanzahl und das Wettbewerbsumfeld. Für Letzteres muss im Vorfeld natürlich auch beleuchtet werden, ob die aktuelle Personalstärke ausreichend ist und die Infrastruktur der Praxis noch Reserven vorhält. Die Bewertung der Infrastruktur muss dabei mit Blick auf die Auslastung der Behandlungszimmer erfolgen, oder aber die Nutzung bzw. den Ausbau weiterer Flächen, sofern dies möglich ist. Auch die Ausweitung der Sprechzeiten kann ein guter Ansatz sein. In allen Fällen braucht es jedenfalls eine entsprechend angepasste Anzahl an Mitarbeitern/-innen. Für die Herkunft der Einnahmen sind als Zielquote mindestens die hälftige Verteilung durch KZV und private Zahlungen definiert. Dabei berücksichtigen private Zahlungen auch Einnahmen wie Patienteneigenanteile beim ZE, PZR-Honorare etc. sowie natürlich die Einnahmen durch PKV-Patienten. Eine weitere Entwicklung zugunsten der Einnahmen durch private Zahlungen ist selbstverständlich erstrebenswert.
Individuelle Praxispotenziale kennen und nutzen
In der weiteren detaillierten Betrachtung sind die Behandlungsbereiche und die damit jeweils erbachten Honorare von zentraler Bedeutung, da sich daraus ganz individuelle Potenziale der Praxis ableiten lassen. Geografische Besonderheiten oder Behandlungsschwerpunkte werden in der nachfolgenden Betrachtung von Potenzialen nicht berücksichtigt.
PZR
In einer modernen und zeitgemäßen Praxis ist die PZR eine fest etablierte Leistung und wird bei GKV-Patienten/-innen im Bundesdurchschnitt mit 100 bis 120 Euro berechnet. In einer entsprechend organisierten Praxis, mit einer ZMP im Team, ist davon auszugehen, dass ca. 60% der GKV-Scheine bzw. Patienten/-innen für eine PZR-Behandlung begeistert werden können. Um diesen Wert für die Praxis zu überprüfen, reicht in der Regel die Filterung der GKV-Scheine. Selbstverständlich ergeben sich ähnliche Potenzialquoten bei den PKV-Patienten/-innen. Bei durchschnittlich 600 GKV-Scheinen bzw. Patienten/-innen pro Quartal sollten also 360 Patienten/-innen eine PZR-Behandlung in Anspruch nehmen. Dies entspricht bei einem Zeitfenster von 60 Minuten pro PZR inkl. Vor- und Nachrüstzeit 120 PZR-Behandlungen pro Monat, sodass eine ZMP gut ausgelastet ist, insbesondere vor dem Hintergrund weiterer Behandlungen wie z.B. den IP-Leistungen für Kinder und Jugendliche. Geht man von einer 100%igen Termintreue der Patienten/-innen, so kann eine ZMP mit PZR-Behandlungen durchaus ca. 13.000 Euro in einer Praxis erwirtschaften. Unter Berücksichtigung von Urlaub, Feiertagen, Fortbildung oder Krankheit führt eine ZMP etwa 10 Monate im Jahr Behandlungen durch, sodass mit einem Jahresumsatz von ca. 130.000 Euro gerechnet werden kann. Diesen Einnahmen stehen natürlich individuelle Kosten gegenüber, wie z.B. Personalkosten von etwa 50.000 Euro, anteilige Rezeptions- und Raumkosten, Materialkosten, Instandhaltungskosten etc. Dennoch ist das Angebot der PZR durch eine ZMP in der Praxis durchaus rentabel, zumal viele weiterführende Behandlungen im Rahmen der Prophylaxesitzung angestoßen werden können und sollten.
PAR-Behandlung
Neben der PZR bietet auch die PAR-Behandlung in der Regel großes Potenzial, wenngleich der aktuell gültige HVM für viele Praxen ein Hemmschuh ist, da bei Überschreitung erhebliche Honorarkürzungen drohen. Für die Patienten/-innen sinnvolle Zusatzleistungen können mitunter drohende Honorarkürzungen entschärfen. Hier bieten sich Behandlungen mit einem Laser oder PRF an. Übrigens lassen sich die Praxispotenziale sehr gut mithilfe der Fünften Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS V) ableiten, die den Behandlungsbedarf bei den 35- bis 44-Jährigen bei 51,6% sieht, bei den 65- bis 74-Jährigen bei 64,6% und bei den über 75-Jährigen bei 90%. Mit einer Filterung der Altersklassen lässt sich in der Praxis also recht zuverlässig das Behandlungspotenzial für PAR-Patienten/-innen in Verbindung mit der DMS V ausschöpfen. Darüber hinaus ist der regelmäßige Recall der Bestandspatienten/-innen als enorm wichtiges Instrument im Zusammenhang mit dem HVM anzusehen.
Bleaching
Interne Studien* belegen, dass etwa 25% der erwachsenen Patienten/-innen mit Ihrer Zahnfarbe unzufrieden sind und sich eine hellere Zahnfarbe wünschen. Von dieser Patientengruppe entscheiden sich etwa 20% nach entsprechender Aufklärung für ein Bleaching. Diese Patientengruppe kann ebenfalls ohne großen Aufwand über die Verwaltungssoftware der Praxis gefiltert werden. Von den 600 GKV-Scheinen pro Quartal bzw. 2.400 GKV-Scheinen pro Jahr in der Durchschnittspraxis ergeben sich etwa 1.650 einzelne Patienten/-innen, da häufig manche auch quartalsübergreifend oder 2-mal jährlich zur Kontrolle kommen. 80% der 1.650 Patienten/-innen sind Erwachsene, und von denen wiederum ca. 412 mit der individuellen Zahnfarbe unzufrieden. 82 Patienten/-innen werden sich laut interner Studien* für ein Bleaching entscheiden. Dies entspricht in etwa 7 Bleachings pro Monat. Bei durchschnittlich 300 bis 400 Euro Honorar pro Behandlung ergeben sich in einer Durchschnittspraxis Honorare von ca. 30.000 Euro. Nebenbei ist auch der Empfehlungsfaktor bei zufriedenen Bleaching-Patienten von zentraler Bedeutung für die Praxis.
Aligner-Behandlung
Neben Bleachings sind auch Aligner-Behandlungen ein großer Trend für die Praxis und erfreuen sich regelmäßiger Nachfrage von Patienten/-innen. Sie haben nicht selten auch medizinischen Bezug und können beeinträchtigende Fehlstellungen beheben oder die Möglichkeiten zur Mundhygiene verbessern. Unabhängig von der Indikation sind Aligner-Behandlungen, richtig umgesetzt, ein attraktives Behandlungskonzept. Auch hier belegen interne Studien*, dass sich die Patientengruppe mit Interesse an einer Aligner-Behandlung in einer Durchschnittspraxis sehr konkret ermitteln lässt. 67% der Erwachsenen haben in der Regel eine Fehlstellung, die in 80% der Fälle mit einer Aligner-Behandlung therapiert werden kann. Mit einer entsprechenden Aufklärung entscheiden sich 17% für eine Aligner-Behandlung. Auch diese Zahl lässt sich durch die Praxissoftware individuell ermitteln. Bei durchschnittlichen Honoraren von 1.600 Euro und mehr pro Aligner-Behandlung sollte diesem Thema unbedingt Aufmerksamkeit geschenkt werden. Unterstützend wirken sich hier auch Teilzahlungsangebote durch Factoring-Dienstleister aus.
Füllungstherapie
Die KZBV veröffentlich regelmäßig die Anzahl der diversen Füllungen nach Flächenanzahl auf 100 Patienten/-innen. Das sind im Bundesdurchschnitt etwa 12 1-flächige Füllungen, 19 2-flächige Füllungen, 9 3-flächige Füllungen und 6 Füllungen mit mehr als 3 Flächen. Bezogen auf die Praxis lassen sich diese Werte ebenfalls über die Verwaltungssoftware anhand der Leistungsstatistik problemlos filtern. Für die Durchschnittspraxis ergibt sich bei 600 GKV-Scheinen eine Anzahl von 276 Füllungen, von denen mindestens 50% mit Mehrkosten verbunden sind. Gängige Zuzahlungen liegen beginnend bei 60 Euro und steigen um jeweils 20 Euro pro weitere Füllungslage. Für eine Durchschnittspraxis bedeutet es im Mittel ein Mehrkostenhonorar in Höhe von 7.200 Euro. Es gibt aber durchaus Praxen, die deutlich mehr berechnen.
HKP
Das Thema HKP hat für die Praxis auch eine große Relevanz. Nicht zuletzt wegen der üblicherweise höheren Honorarleistung durch Zahnersatzbehandlungen, sondern auch vor dem Hintergrund der HKP-Erstellung und -Umsetzung. Häufig werden fast schon unachtsam HKPs bei der ZMV in Auftrag gegeben, ohne sich im Vorfeld Gewissheit über die konkrete Bereitschaft der Patientin oder des Patienten zu verschaffen. Im Nachgang werden dann regelmäßig 2 oder 3 HKPs erstellt, die häufig interne Kosten von bis zu 200 Euro auslösen. Der Kostenaspekt ist noch zu verschmerzen, wenn es schlussendlich zur Umsetzung eines der HKPs kommt. In der Regel werden aber nur 60% und weniger der geschriebenen HKPs tatsächlich in Auftrag gegeben. Zielquote sollte eine Umsetzung von mindestens 80% der geschriebenen HKPs sein. Besser ist es jedoch, wenn die Aufklärung und Beratung so gut sind, dass nur 1 HKP erstellt werden muss, weil die Patienten/-innen sich kompetent entscheiden können. Das spart Zeit und Geld für die Praxis. Wenn dann die Patienten/-innen trotzdem keine Termine vereinbaren, sollte ein entsprechendes erfolgreiches Nachfasskonzept entwickelt werden.
Umsatzverteilung
Bei mehreren Zahnärzten/-innen in der Praxis muss auf die jeweiligen Anteile an den Gesamtumsätzen der zahnärztlichen Honorare geachtet werden. Eine übermäßige Abhängigkeit von einzelnen Behandlern/-innen ist in jedem Fall zu vermeiden. Grundsätzlich sollte ein zahnärztliches Honorar von mindestens 350 Euro pro Stunde in der Praxis erwirtschaftet werden. Sofern eine ZMP in der Praxis tätig ist, sollte diese weitere 80 Euro pro Stunde beisteuern. Bei mehreren zahnärztlichen Behandlern/-innen oder ZMP-Kräften in der Praxis sind diese Werte leicht zu erreichen.
Fazit
Mit den hier genannten Praxiskennzahlen lassen sich individuell Ist- und Soll-Zahlen in Form eines Praxisbudgets definieren und die Praxis somit steuern und auch entwickeln. Für das Erreichen möglicher Potenziale sollte die Praxis unbedingt das Team mit ins Boot holen. Klare Kommunikation, Transparenz in der Formulierung von Zielen und eine wie auch immer gestaltete Beteiligung des Teams an den zukünftigen Praxiserfolgen hebt jede Praxis auf das nächste Level. Hilfreich sind auch entsprechende Patientenkommunikations-Systeme und eine ansprechende Website sowie regelmäßig gepflegte Social-Media-Kanäle. Hier kann die Unterstützung durch eine erfahrene Marketing-Agentur gute Ansätze liefern.
Natürlich kann man die Praxis noch weiter im Detail betrachten und messen. Hier gilt es beispielsweise, die Auslastung der Praxis zu prüfen, individuelle Mitarbeiterleistungen zu erfassen, individuelle Mitarbeiterentwicklungen umzusetzen, Termindauer und das Nichterscheinen von Patienten/-innen zu dokumentieren, Patientenkategorisierungen vorzunehmen, Entwicklung bzw. Steigerung von Patientenzahlen sowie Kostensenkungspotenziale aufzuspüren u.v.m. Spannend sind auch definierte Behandlungs- und Umsetzungskonzepte. Aber auch die Digitalisierung und automatisierte Recalls begeistern. Die Praxis bietet also ein großes Feld, in dem neben zahnärztlicher Fachexpertise auch das unternehmerische Know-how eine immer größere Rolle spielt.
* Seit 2009 hat die Praxisentwickler GmbH die Prozesse in über 500 Praxen evaluiert. Die Auswertungsergebnisse dieser Daten bilden die Grundlage für die internen Studien des Autors.
 Entdecke CME Artikel
Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download
Entdecke Artikel mit Download 

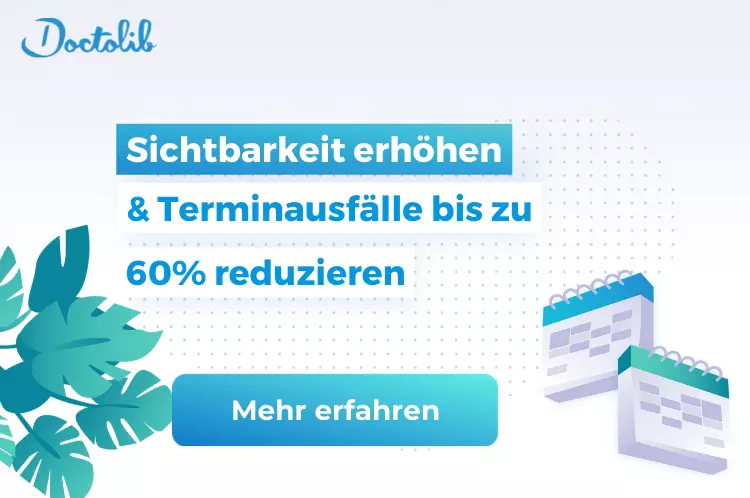



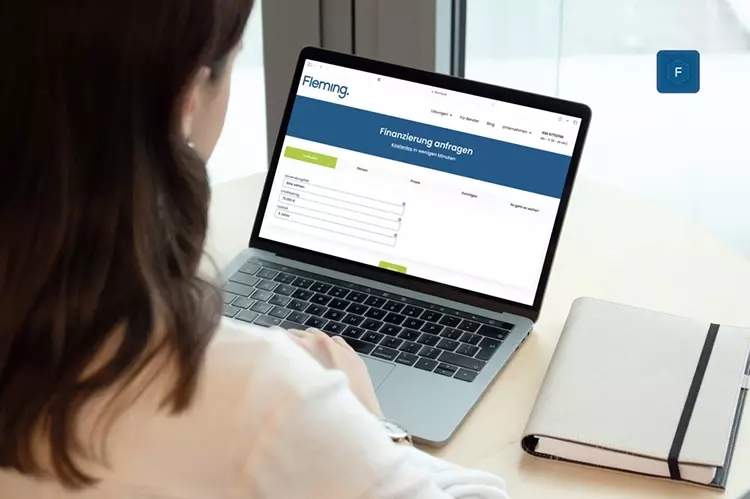
 Mit Google einloggen
Mit Google einloggen
 Mit Facebook einloggen
Mit Facebook einloggen
Keine Kommentare.