|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
PD Dr. Gerhard Schmalz (Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Universität Leipzig) startete seinen Einblick zur Anwendung lichtbasierter Verfahren im Kontext periimplantärer Erkrankungen mit Ausführungen zur Besonderheit der periimplantären Mukositis und Periimplantitis, und den gängigen Therapiekonzepten der zugrundliegenden Erkrankungszustände. Im Vergleich zu parodontalen Erkrankungen liegen bei einer Periimplantitis aggressivere Destruktionen und äußerst heterogene Erkrankungsbilder zugrunde; zudem zeigt sich insgesamt eine komplexe Situation, wie z.B. in anatomischen Voraussetzungen und immunologischen Rahmenbedingungen. Bei jährlich einer Million gesetzter Implantate in Deutschland und bei einer anzunehmenden Periimplantitisprävalenz von 15 bis 20% nach zehn Jahren, stehen Zahnärzte/-innen deshalb vor einer (zunehmenden) Herausforderung in der Prävention und/oder Therapie periimplantärer Erkrankungen. Um dem Problem Periimplantitis adäquat vorzubeugen zu können, liegt nach Schmalz das Hauptaugenmerk auf der Frage nach geeigneten Präventionsstrategien.
Bezüglich der Gesamteinordnung von Implantaten und den darauf abgeleiteten (nachfolgenden) Maßnahmen in Prävention und Therapie müssen diese zunächst als Fremdkörper betrachtetet bzw. verstanden werden. Ein Implantat heilt nach der OP idealerweise knöchern ein (Osseointegration), wobei das gesamte implantatumgebende Hart- und Weichgewebe als Narbe verstanden werden muss. Deshalb sind hier immunologische Besonderheiten zu berücksichtigen: Es liegen Fremdkörperriesenzellen ähnlich denen am Gelenkspalt von Rheumatikern/-innen vor, sodass „wir eine gewisse Autoimmunität haben und somit immer eine transiente immunologische Regulation am Implantat vorliegt“, so Schmalz. Demnach unterscheiden sich Periimplantitis und Mukositis in ihrer Erkrankungsursache. Bei der Mukositis ist die Entzündung des periimplantären Weichgewebes in vielen Fällen primär biofilmassoziiert und damit ein analoges Erkrankungsbild zur Gingivitis – jedoch hier mit einer ausgeprägteren Vulnerabilität gegenüber Erkrankungsentstehung und -progression.
Demgegenüber liegt bei der Periimplantitis aufgrund eines vor allem immunologischen Ungleichgewichts zwischen Implantat und Wirt eine Dysregulation mit einer möglichen, subsequenten bakteriellen Kontamination vor. Bei ausbleibender Therapie kommt es nunmehr zum progredienten Knochenabbau. Schmalz führte weiter aus, dass der Biofilm am Implantat und das mikrobiologische Milieu mit Beteiligung klassischer potenziell parodontalpathogener Bakterien, aber auch Hautkeimen, Pilzen und Viren in einer ganz anderen Größenordnung viel heterogener und umfangreicher als am Zahn ist. Sein Fazit: „Wir haben bei der Periimplantitis eine höhere Komplexität in der Ätiologie und Pathogenese der Erkrankung, hier gelten gewissermaßen andere Regeln. Hier trägt der Biofilm insbesondere zu einer Verschlimmerung des Krankheitsbildes bei.“
Therapie und Prävention der Mukositis sowie Periimplantitis
Leitlinien-basiert [1] umfasst die Therapie und Prävention der periimplantären Mukositis die mechanische Biofilmkontrolle mit regelmäßig durchzuführender Implantatreinigung (häuslich und professionell) und Mundhygieneinstruktion für eine adäquate persönliche Implantatpflege. Hingegen ist der Zusatznutzen von Adjuvantien wie Antiseptika bislang eher als fraglich einzuordnen. Die Therapie umfasst zudem die Kontrolle der Risikofaktoren (schlechte Mundhygiene, Rauchen, parodontale Vorerkrankung, Begleiterkrankungen). Eine wenn auch gegenüber Gingivitis verzögerte Reversibilität ist bei Mukositis jedoch gegeben.
Aufgrund der Chance, durch adäquate Zahn- und Implantatpflege einen wesentlichen Risikofaktor für die Entstehung und Progression der periimplantären Mukositis bis hin zu Periimplantitis zu eliminieren, hat Schmalz zufolge die häusliche/persönliche Biofilmkontrolle einen hohen und Stellenwert und man hat demnach auch die „Chance, mit lichtbasierten Verfahren präventiv und therapeutisch einzugreifen, um bereits frühzeitig die Problematik einer Mukositis anzugehen“.
Kommt es zu einem entzündlichen Knochenverlust, liegt nunmehr eine Periimplantitis vor. Dieser geht oftmals, aber nicht zwingend, eine Mukositis voraus. Auf dieser Grundlage ist eine zielgerichtete Periimplantitistherapie einzuleiten. Diese beginnt zunächst auch nicht-chirurgisch analog der Mukositistherapie, hat aber nur einen sehr eingeschränkten Effekt und kann ggf. durch zusätzlichen Einsatz einer lokalen Antibiose (Doxycyclin) unterstützt werden. In den meisten Fällen mündet die Therapie allerdings in einen chirurgischen Eingriff zur Rehabilitation implantatumgebender Strukturen und bedarf nachfolgend einer risiko- und bedarfsgerechten Prävention, um eine Stabilität am Implantat zu gewährleisten. Ein Blick auf die regenerativen Verfahren in diesem Zusammenhang zeige, dass die Indikationen dazu begrenzt und die Prognose häufig schwierig einzuschätzen bzw. vorhersehbar ist. Die Prävention einer Periimplantitis beginnt bereits in der präimplantologischen Phase mit entsprechender Implantatplanung, Materialauswahl, Indikationsstellung, Patientenselektion und -instruktion sowie bedarfsgerechter Vorbehandlung wie z.B. parodontale Rehabilitation. Es folgen Implantation und prothetische Versorgung sowie die postimplantologische Phase mit (lebenslanger) präventiver Betreuung.
Ab diesem Zeitpunkt müssen die Patienten/-innen ihre Implantate adäquat pflegen, dazu müssen sie gut instruiert und motiviert sein und regelmäßig unterstützt werden. Deshalb sollte die präventive Nachsorge im ersten Jahr nach Implantation alle drei bis vier Monate erfolgen, um anschließend risiko- und bedarfsabhängig die Patienten/-innen in die individual-präventive Betreuung (= Nachsorgeprogramm) zu integrieren. Die regelmäßige Erfassung der Sondierungstiefen in Kombination mit der Erfassung der Blutung (BOP) am Implantat ist dabei ein wesentlicher Schlüssel zur Kontrolle bzw. Überprüfung der Implantatgesundheit. Eine Zunahme der Sondierungstiefen (heute arbeitet man nicht mehr mit festen Sondierungstiefenwerten) in Kombination mit Entzündungszeichen (profuse Blutungen/Suppuration) entscheidet dann über die weiterführenden Maßnahmen wie bspw. Röntgendiagnostik zur Abklärung einer vorliegenden Periimplantitis und die Einleitung einer entsprechenden Periimplantitistherapie.
Lichtbasierte Therapie im Kontext periimplantärer Gesundheit
Die Leitlinie spricht sich dafür aus, dass eine adjuvante aPDT bei der nichtchirurgischen Therapie der Periimplantitis zum Einsatz kommen kann. Ein Blick in die aktuelle Literatur von Therapieverfahren zeigt nach Ansicht von Schmalz, dass es derzeit aufgrund der Heterogenität der Studienlage und fehlenden Langzeitergebnissen „eigentlich nicht möglich ist, eine wirklich klare Aussage für den Einsatz lichtbasierter Therapieverfahren in der Periimplantitistherapie zu treffen, auch wenn der Methode einiges zugetraut wird“ [2]. Möglicherweise könne durch Anwendung mit der PDT in der Zahnarztpraxis kurzfristig eine Reduktion der mikrobiologischen Kontamination erzielt und damit die Begleitinfektion bekämpft werden – das Problem der Fremdkörperreaktion werde mit dieser Form der PDT aber nicht gelöst. Deshalb sieht er für sich in einer professionell durchgeführten PDT im Rahmen der Periimplantitistherapie nicht den Durchbruch, aber die Chance, eine Entzündungsreduktion zu beschleunigen.
Eine Metaanalyse [3], die PDT mit Antibiotika bei Periimplantitistherapie vergleicht, zeigte, dass die PDT zwar einen ähnlichen Effekt wie Antibiotika (Reduzierung von Mikroorganismen) ausübt, Antibiotika bei Periimplantitis aber keinen relevanten Mehrgewinn erzeugen, weil sie nicht ausreichend in die implantatumgebenden Strukturen gelangen und damit lediglich im geringen Umfang die Immunantwort indirekt modellieren. Ein weiterer aktueller systematischer Review [4] schlussfolgerte einen möglichen Mehrgewinn einer PDT zur Reduktion der periimplantären Entzündung. Die eingeschlossenen Studien sind jedoch methodisch ausgesprochen heterogen und weisen in den meisten Fällen ein hohes Biasrisiko auf. Der Aussage, dass die Biofilmentfernung mit PDT in Kombination mit konventionellen Behandlungsmethoden effektiver ist, folge er deshalb, und schlussendlich auch unter Berücksichtigung der Leitlinienempfehlung (s.o.) nicht. Demgegenüber teilt er eine andere Einschätzung zur PDT in der Homecare-Anwendung im Rahmen der persönlichen Biofilmkontrolle.
Tägliche lichtbasierte Homecare-Anwendung als Chance nachhaltiger Biofilmkontrolle
Aufgrund der Biofilmassoziation der Mukositis sieht Schmalz einen potenziellen Nutzen für die Prävention und Therapie der Mukositis durch Biofilmkontrolle mittels häuslich angewandter PDT in Ergänzung zur mechanischen Biofilmkontrolle, wie sie mit Lumoral administriert wird. Die Homecare-Anwendung bei Lumoral mache auch deshalb viel mehr Sinn als eine einmalige professionelle lichtbasierte Entfernung des Biofilms in der Zahnarztpraxis, weil es hier, wie beim regelmäßigen Zähneputzen, auf die tägliche und damit stetige Reduktion der mikrobiologischen Belastung ankommt. Aufgrund des Mehrwertes des Homecare-Settings widerspreche seine Aussage nicht der von der Leitlinie ausgesprochenen Empfehlung.
Sein Fazit: Lumoral ist eine Möglichkeit für die Prävention der Mukositis, die weitere Evaluation für das Homecare-Setting bedarf, insbesondere unter der Fragestellung, welchen Effekt die Wärmeentwicklung langfristig am Implantat ausübt. Bei vorhandenen Implantaten sieht er in der Prävention der Mukositis grundsätzlich ein entsprechendes Präventionspotenzial. Letztlich sei ein „lichtbasiertes Homecare-Verfahren als Prävention, um Zähne zu erhalten, die beste Periimplantitisprävention, die wir uns vorstellen können, weil dann keine Implantate gesetzt werden müssten“.
 Entdecke CME Artikel
Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download
Entdecke Artikel mit Download 





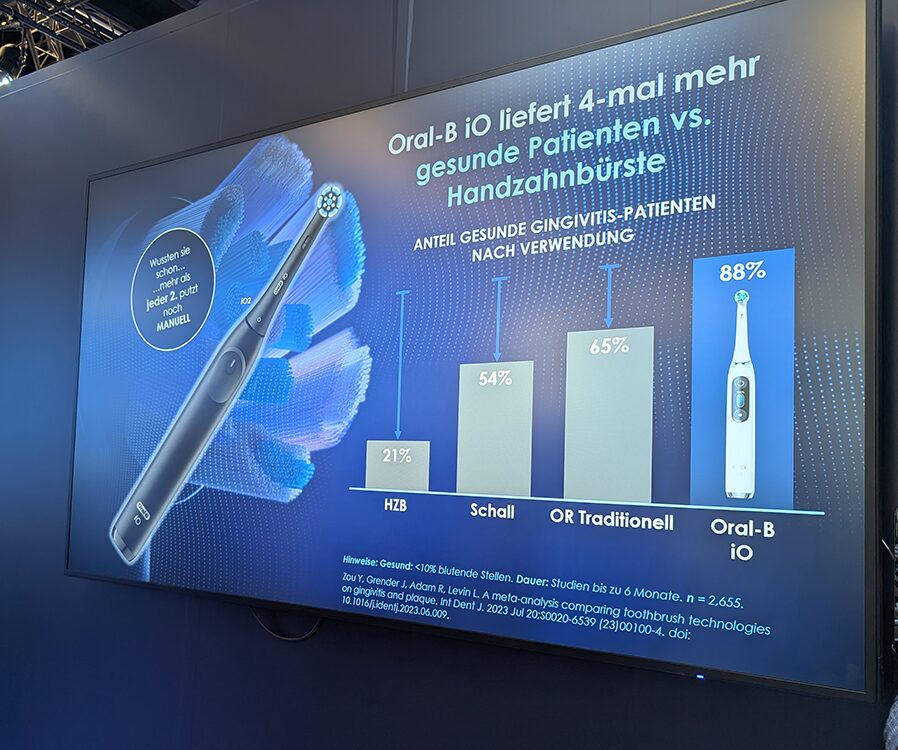

 Mit Google einloggen
Mit Google einloggen
 Mit Facebook einloggen
Mit Facebook einloggen
Keine Kommentare.