Der Begriff des „Kaltpolymerisates“ rührt daher, dass zum Reaktionsstart der Polymerisationsreaktion im Gegensatz zu den Heißpolymerisaten keine Wärmezufuhr notwendig ist. Alternativ wird der Begriff „Autopolymerisat“ verwendet. Der Reaktionsstart erfolgt durch eine chemische Reaktion. Dazu wird ein Redoxsystem verwendet, in dem Radikale erzeugt werden, die den Polymerisationsprozess des Polymethylmethacrylates in Gang setzen. Dabei wird es dann auch heiß, denn hier handelt es sich ebenfalls um eine exotherme Reaktion.
Redoxsystem: Dibenzoylperoxid (DBPO) und N,N-Dimethyl-ptoluidin
Dieses System gehört zu den ersten Kunststoffen, die als Autopolymerisate entwickelt wurden, und ist auch heute noch erhältlich. Es sind robuste Systeme, die bei dünnen Schichten wie z. B. bei Unterfütterungen auch ohne spezielle Polymerisationsgeräte verarbeitet werden können.
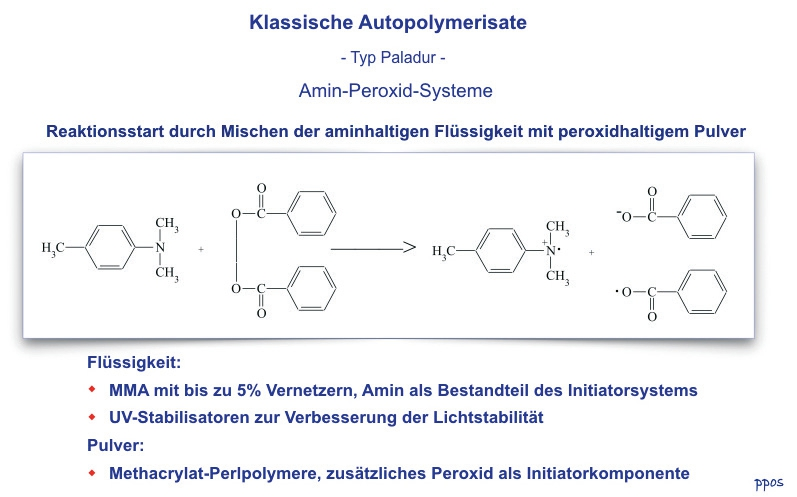 Prof. Dr. Peter Pospiech
Prof. Dr. Peter Pospiech
Die Verarbeitung in der Gießtechnik bringt allerdings den Nachteil mit sich, dass im Vergleich zu den Heißpolymerisaten der Monomeranteil erhöht ist und die Gefahr von Sensibilisierungen bei zu viel Restmonomer besteht. Deshalb sollte in jedem Fall auch die Aushärtung im warmen Wasserbad erfolgen, um ein Zuviel an Restmonomer zu vermeiden.
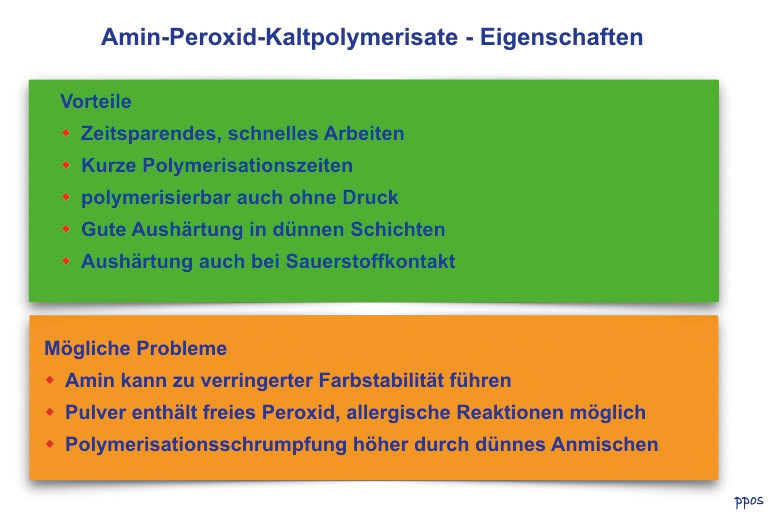 Prof. Dr. Peter Pospiech
Prof. Dr. Peter Pospiech
Weiterführende Links
- Kunststoffe – Teil 1
- Kunststoffe – Teil 2: Die Polymerisation
- Kunststoffe – Teil 3: Polymerisationsmechanismen
- Kunststoffe – Teil 4: Prothesenkunststoffe
- Kunststoffe – Teil 5: Prothesenkunststoffe (2)
Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels
 Entdecke CME Artikel
Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download
Entdecke Artikel mit Download 




 Mit Google einloggen
Mit Google einloggen
 Mit Facebook einloggen
Mit Facebook einloggen
Keine Kommentare.