|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
 DKB
DKBDas innovative Kongresskonzept der DGKiZ mit einem gemeinsamen Programm für Behandler und Team am ersten Kongresstag wurde gut angenommen – 50 Praxisteams waren vertreten (Abb. 1). Thema des gemeinsamen ersten Kongresstages war die Kommunikation in der Praxis: Herausforderungen durch Konflikte und spezielle Patientengruppen sowie Chancen, die in der Lösung von Konflikten, im Patientengespräch und in der interprofessionellen Kommunikation liegen.
Kommunikation birgt Konfliktpotential, da sie ein komplexer Vorgang ist, der mitunter zu Missverständnissen führt. Man denke an das bekannte Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun – auch als „Vier-Ohren-Modell” bekannt [1]. Was auf der Sachebene als neutrale Botschaft gesagt wird, kann auf dem Beziehungsohr negativ als Angriff aufgenommen werden. Doch „ein gut gelöster Konflikt kann uns weiterbringen!“, wie Dr. Nicola Meißner (Berlin) im Eingangsreferat feststellte (Abb. 2). Eine Konfliktlösung in der Zahnarztpraxis unter Teammitgliedern kann als ein Abgleich einer Ist-Soll-Diskrepanz betrachtet werden, die eine sinnvolle Neuverteilung von Aufgaben oder Gütern erfordert. Entscheidend sei, den Konflikt auf der Win-Win-Ebene abzuholen und nicht abzuwarten, bis dieser in einem „Rosenkrieg“ eskaliert, der nur noch Verlierer hervorbringt. Der Führungskraft komme eine „Schiedsrichterrolle“ zu. Auf emphatische Weise solle sie helfen, einen Ausgleich auszuhandeln, der für alle Beteiligten passt.
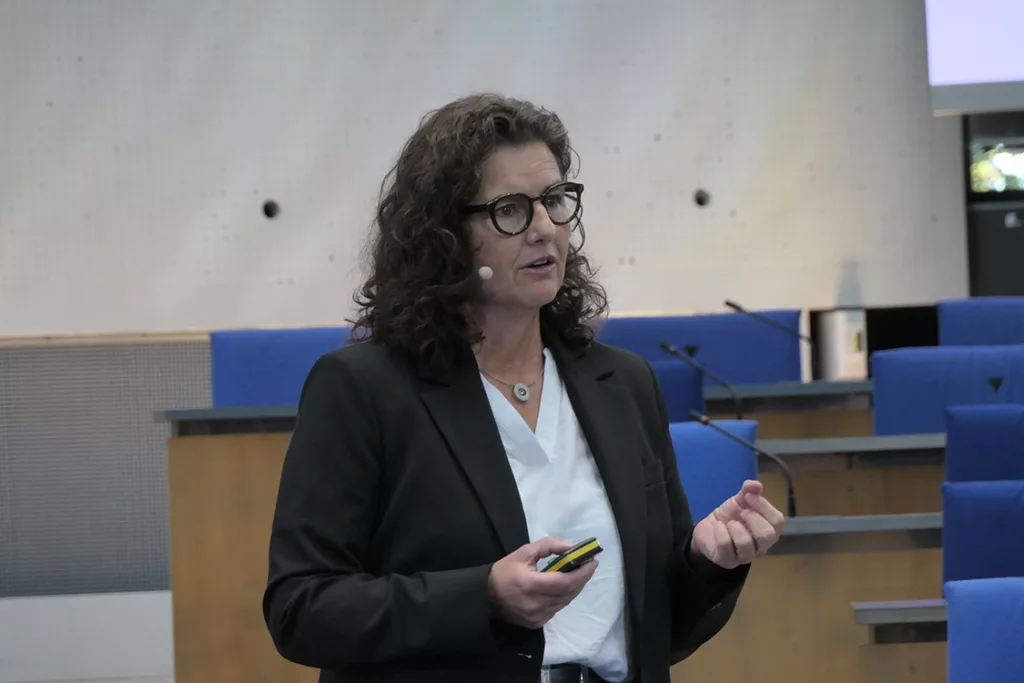 DKB
DKBVon ängstlichen Kindern und störenden Eltern
In der Kinderzahnmedizin setzt die Kooperationsfähigkeit der jungen Patientinnen und Patienten häufig Grenzen für die Behandlung. Oft sind es Ängste, die Kinder eine Behandlung verweigern lassen oder zumindest ihre Mitarbeit einschränken. Eine aktuelle Metaanalyse ergab, dass rund ein Drittel der jungen Patienten (Vorschulkinder 36,5%, Schulkinder 25,8%) mit Zahnbehandlungsangst in die Praxis kommt [2]. Diplom-Psychologin Dr. Jutta Markgraf-Stiksrud (Gießen) ging in ihrem Vortrag dem angemessenen Umgang mit der Zahnbehandlungsangst ohne Krankheitswert (unterschieden von der Phobie) bei Kindern nach. Es gelte herauszufinden, was diese Kinder spezifisch ängstigt, um eben dies in der Behandlung zu vermeiden und damit die Bedrohlichkeit der Situation für sie zu reduzieren. Darüber hinaus wünschen sich junge Patientinnen und Patienten ihrem Behandler vertrauen zu können, sie möchten vorbereitend informiert werden und kontrollieren, was geschieht. Die Referentin gab keine Empfehlung für eine spezifische Technik der Kommunikation, da es in erster Linie darauf ankomme, das Kind wahrzunehmen und ihm zu ermöglichen, Angstbewältigungsstrategien zu entwickeln.
Im Vortrag der DGKiZ-Vizepräsidentin Dr. Isabell von Gymnich (Regensburg) ging es um positive Kommunikation mit den Eltern von Patienten. Eltern können unabsichtlich den Behandlungsablauf mit tröstenden Worten oder unglücklichen Bemerkungen boykottieren. Um dies zu verhindern empfiehlt es sich, bereits vorab Behandlungsabläufe separat mit Eltern zu klären und Wünsche an die Eltern zu formulieren (s. Homepage https://www.kinderzahnfee.de/infos-fuer-eltern#erster-besuch). Um eine gute Kommunikationsebene mit den Eltern zu etablieren, empfiehlt Dr. von Gymnich u.a. positive Formulierungen, eine offene Körperhaltung und einen scharfen Blick auf die Körpersprache der Eltern, denn diese kündigt ungünstiges Verhalten an, dem es zuvorzukommen gilt. Ein Beispiel: überbesorgte unruhige Eltern können „abgeholt“ werden, indem sie die Füße ihres Kindes in den Händen halten dürfen und so aus ihrer Sicht einen Beitrag zur Behandlung leisten können.
Kommunikation als Präventionsinstrument
 DKB
DKBZwei Vorträge widmeten sich der Kommunikation bei Verdachtsmomenten auf Essstörungen bzw. auf Kindeswohlgefährdung. Dr. Karolin Höfer (Köln) betonte die Bedeutung des „Motivational Interviewing“ zur Gesprächsführung mit den von Essstörungen betroffenen Jugendlichen (Abb. 3). Das Motivational Interviewing ist eine evidenzbasierte Kommunikationsstrategie von Rollnick & Miller zur motivierenden Gesprächsführung in der Praxis (s. https://www.motivationalinterviewing.org). Sie ist beispielsweise in der Raucherentwöhnung und der Motivation zur besseren Mundhygiene erprobt. Orale Befunde, die auf eine Essstörung hindeuten, sind: Zahnhartsubstanzverlust, Parodontalprobleme, Cheilitis angularis, vergrößerte Speicheldrüsen, Xerostomie und Schleimhautveränderungen. Zahnhartsubstanzverluste aufgrund häufigen Erbrechens und starkem Konsum säurehaltiger Getränke betreffen oft palatinale Flächen des Oberkiefers, der Zahnschmelz erscheint glatt und glänzend, die Schneidezähne können verkürzt sein und die okklusalen Flächen schwinden nach und nach. Im Rachenbereich können kleine punktförmige Einblutungen durch wiederholtes Erbrechen und Verletzungen des Rachens auftreten.
Prof. Sibylle Banaschak, Rechtsmedizinerin, informierte über den Umgang mit Verdachtsfällen von Misshandlung oder Vernachlässigung. In der Klinik oder Praxis können Verletzungen nach Gewalteinwirkung auffallen. In Fällen, die merkwürdig erscheinen, solle eine Plausibilitätsprüfung, ob das Verletzungsmuster zu der abgegebenen Erklärung passt, erfolgen. Beruf der Eltern oder Freundlichkeit im Umgang seien keine guten Indikatoren für die Einschätzung der Situation, bemerkte die Referentin. Zahnärztinnen und Zahnärzte sollen bei entsprechenden Anzeichen interkollegialen Austausch suchen und fachlichen Rat einholen und/oder das Jugendamt informieren. Die zahnärztliche Schweigepflicht ist in diesen Fällen aufgehoben (§4 KKG). Ansprechpartner in NRW ist das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen (Leitung: Prof. Banaschak), bundesweit steht die Kinderschutzhotline (0800 19 21000) zur Verfügung.
Was tun, wenn die Sprache eine Barriere ist?
PD Dr. Ghazal Aarabi (Hamburg) sprach über sprachliche und kulturelle Hürden (Abb. 4). Um diese erfolgreich zu nehmen, seien professionelle Dolmetschende oder zweisprachige Mitarbeitende gegenüber Angehörigen als Übersetzende in der Zahnarztpraxis vorzuziehen, um Missverständnisse zu vermeiden und Diagnosen korrekt zu übermitteln. Interessante Angebote für den Abbau von kulturellen und sprachlichen Hürden sind: IPIKA, ein Fortbildungsangebot der Charité Berlin zur Stärkung interkultureller und -professioneller Kompetenzen für Ärzte, Pflegekräfte und Sozialdienstmitarbeitende, sowie MiMi, eine Gesundheitsinitiative mit Migranten für Migranten zur Schulung von interkulturellen Gesundheitsmediatoren als Multiplikatoren für gesunde Lebensweise. Für die Zahngesundheit haben Dr. Aarabi und Team eigens die Zahnapp MuMi, ein kultursensibles Schulungsprogramm in verschiedenen Sprachen, entwickelt. Der Bedarf an Unterstützung von Menschen mit Migrationsgeschichte ist hoch: Laut DMS · 6 haben Kinder der ersten Migrantengeneration eine dreimal so hohe Karieserfahrung (1,6 Zähne) wie der Durchschnitt in Deutschland lebender 12-Jähriger [3].
 DKB
DKBKommunikation in der interdisziplinären Zusammenarbeit
Dr. Isabelle Graf (Köln) unterstrich die Bedeutung der Kommunikation zwischen Kinderzahnärzten und Kieferorthopäden, insbesondere hinsichtlich einer kieferorthopädischen Frühbehandlung im Milchgebiss und frühen Wechselgebiss. Frühzeitige Intervention kann ausgeprägte Fehlstellungen verhindern, z. B. bei Klasse-II/III-Anomalien oder transversalen Diskrepanzen.
Endo-Update für Zahnmediziner
Am zweiten Hauptkongresstag stand für Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner die Endodontie im Milch- und Wechselgebiss im Fokus. Prof. Jan Kühnisch (München) referierte zur Vitalerhaltung bei tiefen kariösen Läsionen im Milch- und Wechselgebiss (Abb. 5). Unter „tiefer Karies“ wird eine Karies, die bis ins innere Viertel des Dentins reicht, verstanden. Das Therapieziel besteht im Zahnerhalt und in der Vitalerhaltung der Pulpa. Als mögliche Therapieoptionen stellte Prof. Kühnisch Silberdiaminfluorid zur Arretierung der Karies vor. Diese Option „kauft Zeit, das Kind von der Phase der Nichtbehandelbarkeit in die Behandelbarkeit zu überführen“. Als evidenzbasiertes Verfahren für Molaren bietet sich die Hall-Technik, die ohne Präparation auskommt, an. Beides sind evidenzbasierte Verfahren [4,5], Des Weiteren sind Kariesversiegelung mittels Glasinonomerzement oder Versieglungsmaterial an Fissuren/Grübchen möglich. Wird eine restaurative Versorgung vorgenommen, wird nach Leitlinie eine selektive Kariesentfernung empfohlen [6], die pulpanah ledriges Dentin zurücklässt, um eine Eröffnung der Pulpa zu vermeiden.
 DKB
DKBDie Behandlungsmethode der Pulpotomie als partielle oder totale Entfernung der Kronenpulpa stellte DGKiZ-Präsidentin Prof. Katrin Bekes (Wien) vor. Evidenz bieten hier die Guidelines der European Academy of Paediatric Dentistry [6] sowie die jüngst upgedateten Empfehlungen der American Academy of Pediatric Dentistry [7]. Prof. Bekes stellte heraus, dass eine genaue Indikationsstellung mit Röntgenbild, die Technik der Amputation, die Blutstillung sowie die Wahl eines möglichst biologischen Deckungsmaterials entscheidend für den Erfolg seien.
Dr. Maike Jost-Mihrmeister (Köln) empfahl aus der Perspektive einer Schwerpunktpraxis als Überkappungsmaterial bei Pulpotomie Biodentin (Kalziumsilikatzement) und MTA (Mineral-Trioxide-Aggregat), wobei Letzteres Verfärbungen des Zahns zur Folge haben könne. Hinsichtlich der Prognose stellte sie fest, dass der Erfolg nach Trauma höher sei als nach einer Exposition der Pulpa durch Karies, wobei die Expositionszeit eine Rolle spiele. Kein Unterschied sei zwischen wurzelreifen und unreifen Zähnen feststellbar [8]. Die Erfolgsquote nach Pulpaeröffnung und Pulptomie liegt bei 95% in der 3-Jahres-Prognose [9]. Weitere Vorträge zum Themenschwerpunkt Endodontie im Milch- und Wechselgebiss wurden von Dr. Christoph Kaaden (München) zur Behandlung bei nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum und von Dr. Hubertus van Waes (Zürich) speziell zur Traumatologie gehalten.
Neuer Ansatz für ästhetische Korrekturen bei MIH-Frontzähnen
Der von dem Dentalunternehmen DMG gesponserte Vorkongress nahm die Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) in den Blick. Deren Prävalenz liegt hierzulande nach der jüngsten Erhebung im Rahmen der DMS · 6 bei ca. 15,3% (Gruppe der 12-Jährigen) [3]. Vorherrschend sind bei der MIH milde Formen (63,3%).
Bei der Behandlung der MIH steht die Funktionalität betroffener Molaren in der Regel im Vordergrund. Aber auch die Therapie von MIH-Frontzähnen hat hohe Relevanz. Denn die meist weißlich-gelblichen Opazitäten auf MIH-Frontzähnen belasten manche Kinder und Jugendliche in sozial-emotionaler Hinsicht so stark, dass eine ästhetische Verbesserung ihre Lebensqualität erheblich steigert [10,11].
Jüngst wurden vorhandene Behandlungskonzepte upgedatet, da nun mehr Evidenz vorhanden ist – auch für die in erster Linie ästhetische Behandlung im Frontzahnbereich [12]. Dazu kommen neue Möglichkeiten durch ein Bleaching-Medizinprodukt (DMG) mit geringer Wasserstoffperoxid-Konzentration von 5 und 10%, das bei Unter-18-Jährigen für medizinische Zwecke eingesetzt werden darf. Die Referate von DGKiZ-Präsidentin Prof. Katrin Bekes und Dr. Susanne Effenberger (Universität München/Firmenmitarbeiterin DMG) veranschaulichten die neuen Behandlungsmöglichkeiten.
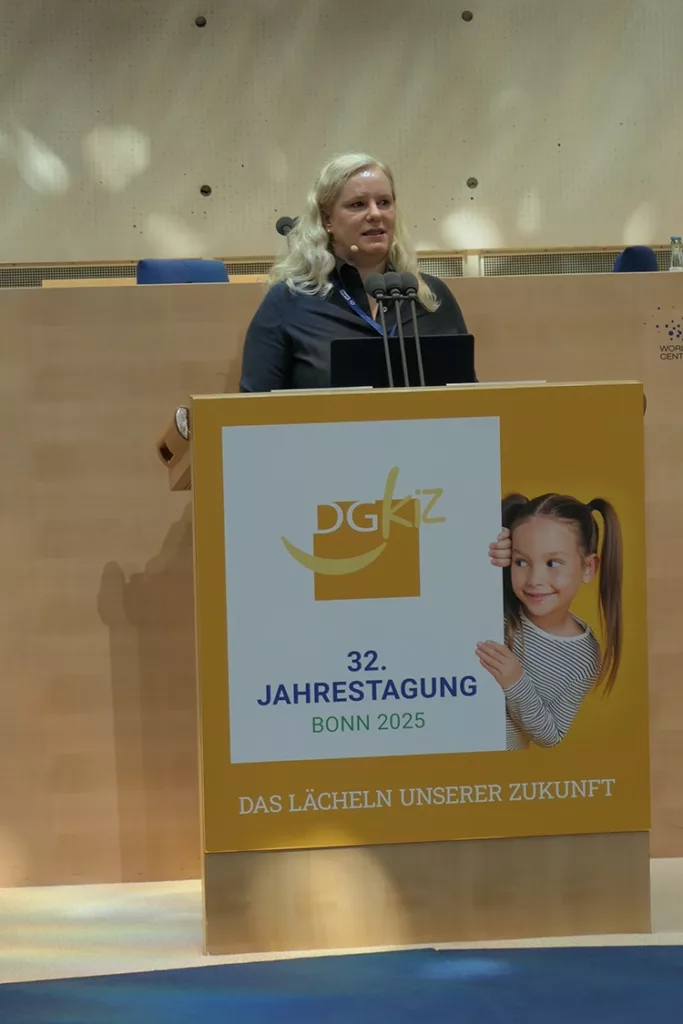 DKB
DKBEin angepasstes Behandlungsprotokoll für die Infiltrationstherapie von MIH-Frontzähnen basiert auf einer speziellen, zusätzlichen Diagnostik. Die Beurteilung unter durchscheinendem Licht („Transillumination“) geht auf Untersuchungen von Prof. David Manton zurück [13]. Die Transillumination ermöglicht Rückschlüsse auf den Typ und die Tiefe der Hypomineralisation bei Frontzähnen, die bei dieser entwicklungsbedingten Fehlbildung unterschiedlich ausfällt. Das Ergebnis der Behandlung einer Infiltration mittels des Kunststoffs Icon Vestibulär (DMG) – Icon ist bekannt aus der Behandlung von Initialkaries – wird somit vorhersagbarer, da es „weniger Unbekannte in der Gleichung“ gebe, so Dr. Effenberger (Abb. 6).
Drei Typen der Opazität können unter Durchleuchtung differenziert werden: Die Hypomineralisation kann sich als zentraler Fleck, als zentral gruppierte Flecken sowie als gestreute Inseln auf der Zahnfläche darstellen. Diese Typen geben einen Anhaltspunkt für die Dauer der Infiltration.
Die Tiefenbestimmung ergibt sich aus dem Aussehen des „Flecks“. Erscheint er mit unklaren Konturen „wie unter einer gefrosteten Glasscheibe“ (Bekes) ist von einer tief unter der Schmelzoberfläche liegenden Hypomineralisation auszugehen, die eine „Läsionstransformation“ erfordert, damit der Infiltrant eindringen kann.
Vor der Infiltrationsbehandlung sollten Verfärbungen im Homebleaching (30min-1h/d) entfernt werden. Falls Zähne hypersensibel sind, bietet sich eine alternierende Anwendung von Bleaching und ACP/PCC (Tooth Mousse, GC) an. Eine Wash-out-Phase ist vor dem Infiltrieren einzuhalten.
Fazit
Das Kongressprogramm vermittelte umfassendes Wissen zu Kommunikation in der Zahnarztpraxis: Sie eröffnet Chancen zu einem besseren Teamwork in der Praxis und ermöglicht die Lenkung junger Patienten und ihrer Eltern. Sie kann sogar Prävention leisten, wenn Essstörungen und Kindesmisshandlung eine ernste Bedrohung von Kindern und Jugendlichen bedeuten. Überdies wurde aus Perspektive von Praxis und Universität fundiertes fachliches Wissen zur Endodontie und Traumatologie in der Kinderzahnmedizin sowie zur Kieferorthopädie vermittelt.
 Entdecke CME Artikel
Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download
Entdecke Artikel mit Download 







 Mit Google einloggen
Mit Google einloggen
 Mit Facebook einloggen
Mit Facebook einloggen
Keine Kommentare.