Bitte loggen Sie sich ein um weiterzulesen
Neu hier?
Jetzt kostenlos unbegrenzten Zugang zu exklusiven Inhalten und Funktionen erhalten.
Kostenlos registrierenoder
Prof. Dr. Beuer, wie stehen Sie grundsätzlich zur Digitalisierung in der Dental-Branche?
Digitalisierung ist das Thema des 21. Jahrhunderts. Und eigentlich muss man sich die Frage stellen, was wir unter den Begriff Digitalisierung verstehen. Wenn wir unter Digitalisierung CAD/CAM verstehen, dann ist das für mich nicht Digitalisierung.
Stellen wir uns ein Labor vor, das eine CAD/CAM-Fräsmaschine besitzt und damit eine Zirkonoxid-Krone herstellt. Dann muss man ehrlicherweise sagen, dass diese Krone auch mit einem Kopierfräser hätte herausgefräst werden können, wenngleich mit etwas mehr Aufwand. Ich habe also durch den Fräsprozess keinen wirklichen Mehrwert.
Von Digitalisierung und von einem echten Mehrwert würde ich erst dann sprechen, wenn mir meine Maschine bestimmte Informationen und Parameter zur individuellen Behandlung verrät, wie z.B. Angaben zur richtigen Schichtstärke oder Angaben zur richtigen Materialwahl angesichts der gegebenen Zahnfarbe und Kaubelastung usw. Das wäre für mich Digitalisierung.
Also nicht einfach nur die Automatisierung von Arbeitsschritten, die ich vorher manuell gemacht habe, sondern auch die Integration von Daten und Informationen, welche man mittels künstlicher Intelligenz und Softwares aus allen verfügbaren Studien gewinnt, die man als Mensch niemals überblicken könnte. Das klassische Beispiel ist die Implantatplanung.
Einige Anbieter nutzen schon künstliche Intelligenz, die – nachdem die Patientendaten eingegeben wurden – das Implantat virtuell an der idealen Position einsetzt. Digitalisierung bedeutet also auch, dass man sich weniger auf sein Bauchgefühl verlassen muss, als es vielleicht heute, aber sicher früher der Fall war. Insofern ist Digitalisierung etwas, das uns Möglichkeiten eröffnet, von denen wir momentan noch gar nichts ahnen.
Thema Werkstoffwissen. Wieviel Werkstoffwissen brauchen Zahnärztinnen und Zahnärzte in der Praxis?
Ich würde sagen, dass sie relativ viel Werkstoffwissen haben sollten, denn als Zahnarzt schreibe ich den Auftrag für das Labor. Und der Laborauftrag hat die gleiche Wertigkeit wie ein Rezept, das ich dem Patienten ausstelle und mit dem er sein Medikament in der Apotheke bekommt. Als Zahnarzt setze ich auch die Konstruktion ein und übernehme damit die volle medizinische Verantwortung.
Materialwissen ist außerdem mit Blick in die Zukunft wichtig, da aufgrund der neuen Approbationsordnung die zahntechnische Ausbildung im Zahnmedizinstudium einen sehr geringen Stellenwert einnimmt. Dadurch wird der Schulterschluss zwischen Zahnmedizin und Zahntechnik immer wichtiger. Angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung ist die Prothetik alles andere als ein Auslaufmodell.
Insbesondere bei komplexeren Versorgungen, vor allem in der Implantatprothetik, lohnt es sich Zahntechnikerinnen und Zahntechniker von Anfang an beim Beratungsgespräch und bei der Planung miteinzubeziehen. Trotzdem sollte ich als Zahnarzt die Schwächen und Stärken der Werkstoffe grundlegend selbst kennen, um für Patienten und Patientinnen individuell sowie unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Ansprüche das beste Material zu bestimmen.
Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Werkstoff Keramik. Wie hat sich insbesondere das Potenzial der Zirkonoxide für prothetische Versorgungen entwickelt?
Meine Liebe zur Keramik habe ich in den 90ern entwickelt. Sprach man damals über eine Keramik-Krone, dann war das schon exotisch und selbst ein Keramik-Inlay war sehr innovativ. Vor 20 Jahren kam so langsam die erste Zirkonoxid-Welle auf.
Plötzlich hatte man einen Werkstoff in der Hand, der Metall-Keramik nachahmte, also eine hochfeste Keramik, die man ähnlich wie eine Metall-Keramik verblenden konnte. Es war damals beeindruckend, eine größere Restauration mit einer relativ hohen Festigkeit herzustellen, ohne wirklich ein Metallgerüst gebraucht zu haben. Das hat mich sehr fasziniert – die Technik dahinter und der Werkstoff an sich.
Zur damaligen Zeit lag mein Fokus auf der Passgenauigkeit der Gerüste und den Weg dorthin. Natürlich musste man verblenden, was das Problem der ersten Zirkonoxid-Generation war und den Werkstoff in Verruf brachte. Stichwort: Verblend-Keramik-Abplatzungen.
Damals ging dann alles in Richtung Lithiumdisilikat, Glaskeramik und Composite. Bis 2011/2012 die transluzenteren Zirkonoxide auf den Markt kamen – die waren der Game-Changer. In Kombination mit der digitalen Technologie haben sie ein gutes Konzept abgegeben, vor allem, wenn es um Seitenzahnrestaurationen ging, da diese zumindest okklusal keine Verblendung mehr brauchten.
Heute wissen wir aus 15 bis 20 Jahren Erfahrung, dass Zirkonoxid ein bewährtes und stabiles Material ist, selbst für größere Arbeiten. Gleichzeitig haben die Hersteller es in den letzten 10 Jahre geschafft immer schönere und transluzentere Zirkonoxide auf den Markt zu bringen, aus denen sich sehr ordentliche und ästhetisch ansprechende Frontzahn-Restaurationen herstellen lassen. Das hat den Werkstoff in den letzten Jahren wieder populär gemacht.
Ein weiterer Aspekt, der zu einer hohen Akzeptanz geführt hat, ist die Tatsache, dass man im Gegensatz zu anderen keramischen Werkstoffen, die wir bisher immer aufwendig adhäsiv befestigen mussten, das Zirkonoxid konventionell zementieren kann, was natürlich den klinischen Umgang sehr viel einfacher macht.
Die Evolution des Zirkonoxids vom hochfesten 3Y-TZP-Typen bis zum superhochtransluzenten 5Y-TZP-Typen ist beeindruckend. Heute gibt es sogar Typen-Multilayer, die unterschiedliche Zirkonoxid-Generationen in sich tragen. Doch wie sieht die Zukunft aus? Was meinen Sie?
 Dental Direkt
Dental Direkt
Sicherlich hat das damit zu tun, dass die hochtransluzenten Zirkonoxide für bestimmte Indikationen, etwa bei großen Seitenzahnbrücken, eher nicht geeignet sind. Darum glaube ich, dass die Typen-Multilayer, also die Kombination der unterschiedlichen Zirkonoxid-Typen in einem Rohling, eine extrem clevere Lösung sind, da sie genau dort Transluzenz geben, wo ich sie brauche, aber auch genau dort Stabilität, wo sie unbedingt nötig ist. Das ist die Gegenwart.
Doch wo geht die Reise hin? Mein früherer Kollege und Freund Josef Schweiger hatte mal die geniale Idee, der Dentin-Kern-Krone. Demnach würde man bei einer digitalen Restauration sowohl den Kern als auch die Schmelzaußenhaut im digitalen Verfahren herstellen. Ich denke, dass das tatsächlich der nächste Entwicklungsschritt sein wird: Mit additiven Verfahren eine mit unterschiedlichen Festigkeiten und Transluzenzen geschichtete und aufgebaute Krone herzustellen, die ähnlich geschichtet und aufgebaut ist, wie der natürliche Zahn selbst.
Was sagen Sie zu Zirkonoxid-Restaurationen aus dem 3D-Drucker?
Das ist ein extrem interessantes Thema, und zwar ein Thema, das mich auch seit 20 Jahren verfolgt. Wir hatten damals schon die Idee, Zirkonoxid-Restaurationen dreidimensional aufzubauen, und haben zu diesem Zweck u.a. mit der Firma EOS und dem Keramik-Lehrstuhl aus Bayreuth ein Projekt gestartet, das wir vor über 10 Jahren abgeschlossen haben. Es stellt sich aber die Frage, wo der Mehrwert von additiv gefertigten Zirkonoxid-Restaurationen ist.
Die Fräs- und Schleiftechnik ist eigentlich so weit fortgeschritten, dass ich erst dann einen richtigen Mehrwert sehe, wenn ich mit der additiven Technik etwas aufbauen kann, das mit der subtraktiven Technik nicht realisierbar ist. Und da denke ich an die geschichteten Dentin-Kern-Kronen, von denen ich vorhin gesprochen habe…
Vielen Dank für das interessante Gespräch!
.
Das Interview wurde im Zusammenhang mit dem Keramik-Kongresses cube days geführt, auf dem Prof. Dr. Beuer einen Vortrag zum Thema „Zirkonoxid 4.0 – Was haben wir aus 20 Jahren klinischer Anwendung gelernt?“ hielt. Dieser sowie viele weitere der Kongress-Beiträge sind online abrufbar.
Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels
 Entdecke CME Artikel
Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download
Entdecke Artikel mit Download 

 Mit Google einloggen
Mit Google einloggen
 Mit Facebook einloggen
Mit Facebook einloggen


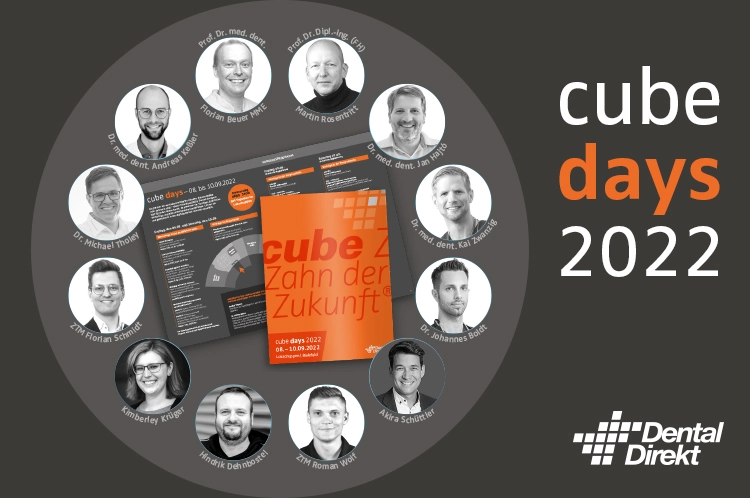

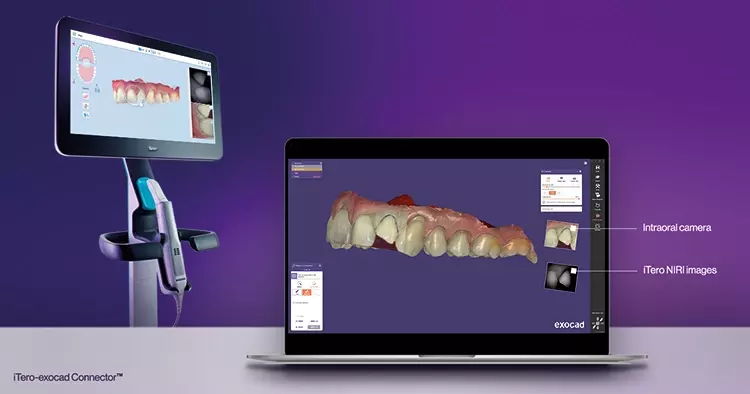

Keine Kommentare.