|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
- 3D-Drucker
- Künstliche optische Strahlung
- Mechanische Gefährdung
- Elektrische Gefährdung
- Kunstharz (Resin)
- Dermale Gefährdung (Gefährdung der Haut)
- Dermale Gefährdung von Familienangehörigen
- Gefährdung der Augen
- Gefährdung der Umwelt
- Isopropanol (IPA)
- Gefährdung durch Dämpfe
- Nachhärtung
- Gefährdung durch heiße Oberflächen
- Weitere Maßnahmen
- Fazit
Zur Herstellung von gedruckten Objekten im Polymerdruckverfahren sind drei Arbeitsschritte notwendig:
1. Herstellung des Objekts im 3D-Drucker mit Kunstharz
2. Reinigung des gedruckten Objekts von Resinresten mit Isopropanol
3. Komplette Aushärtung des Objekts durch Nachhärtung
In jedem dieser Schritte kommen Geräte oder Mittel zum Einsatz, die eine gewisse Sorgfalt und Umsicht erfordern.
3D-Drucker
Der geeignete Platz für den 3D-Drucker wird in den Hinweisen der Hersteller so beschrieben:
- Der Drucker ist an einem Ort aufzustellen, der keinen
ständig benutzten Arbeitsplatz tangiert. - Absaugung oder freie Lüftung sind täglich zu nutzen.
- Aktivkohlefilter binden die Dämpfe und verbessern die
Luftqualität deutlich.
Vom 3D-Drucker gehen folgende Gefahren aus: künstliche optische Strahlung, mechanische Gefährdung sowie elektrische Gefährdung.
Künstliche optische Strahlung
Um das Kunstharz auszuhärten, wird eine Energiequelle benötigt. Dafür kommt LED oder Laser zum Einsatz. Handelt es sich um einen Laser, so ist dieser der Laserklasse 1 zugeordnet. Diese ist als geringe Gefährdung eingestuft und gilt unter normalen Bedingungen als sicher.
Achtung: Wenn das System manipuliert wird, wenn beispielsweise Bauteile am Laser entfernt werden, besteht das Risiko einer Exposition gegenüber einer deutlich höheren Laserklasse. Diese ist dann gefährlich für das Auge, häufig auch für die Haut. Deshalb ist es wichtig, dass keine eigenen Reparaturversuche durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt werden! Dafür ist kompetentes Fachpersonal notwendig. Außerdem verfügt der Drucker über ein Verriegelungssystem, das den Laser automatisch abschaltet, wenn die Abdeckung geöffnet ist. Da es sich um eine technische Schutzmaßnahme handelt, ist es wichtig, das Gerät in regelmäßigen Abständen einer Sichtprüfung zu unterziehen, um zu überprüfen, ob dieser Mechanismus noch ordnungsgemäß funktioniert.
Mechanische Gefährdung
Um das gedruckte 3D-Objekt von der Druckplattform zu lösen, wird oft eine scharfkantige Spachtel verwendet. Zudem besteht beim Abzwicken der Stützkonstruktion vom 3D-Objekt mit dem Seitenschneider die Gefahr, sich zu schneiden. Daher ist darauf zu achten, die Werkzeuge immer vom Körper wegzubewegen. Bei Reinigungsarbeiten im Drucker kann es an beweglichen Teilen sowie an den Leitspindeln zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen. Zum Schutz lange Haare zusammenbinden, Kleidung mit enganliegenden Ärmeln tragen und Schmuck wie Armbänder ablegen.
Elektrische Gefährdung
Bei jedem elektrischen Gerät mit Stromkabel besteht die Gefahr, dass eine Beschädigung dieser Stromzuführung zu einer Körperdurchströmung führt. Diese kann sogar lebensbedrohlich sein. Daher sollte vor der Benutzung eine Sichtprüfung durchgeführt werden, ob die Kabel in Ordnung und frei von Beschädigungen sind. Bei Reinigungsarbeiten im Drucker wird das Gerät vom Stromnetz getrennt.
Kunstharz (Resin)
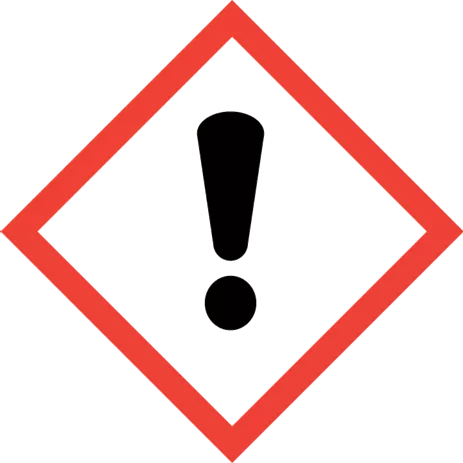
Das flüssige Medium in der Druckwanne des 3D-Druckers besteht größtenteils aus Acrylaten. Damit wird die identische Stoffgruppe verarbeitet wie bei der handwerklichen Herstellung von Kunststoffprothesen. Jedoch handelt es sich beim 3D-Druck um ganz andere Mengen – nicht nur um ein kleines Silikonnäpfchen MMA! Die Wannen im 3D-Drucker fassen meist einen Liter Kunstharz und mehr. Deshalb sind hier auch die Gefährdungen neu zu bewerten.
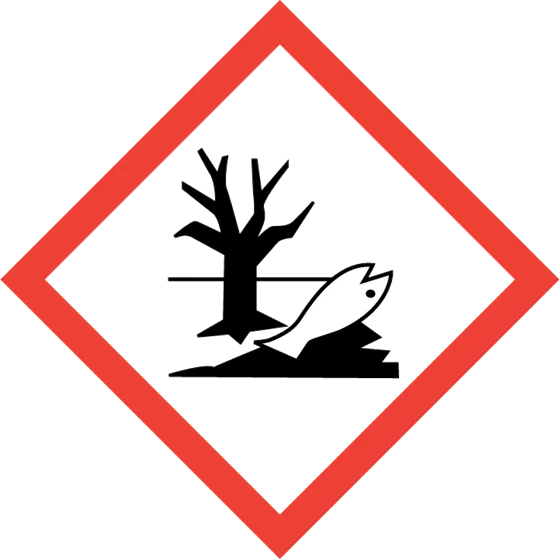
Die Druckflüssigkeit ist mit dem Gefahrenpiktogramm Ausrufezeichen (GHS-Symbol GHS07) gekennzeichnet. Es steht unter anderem für eine Reizwirkung auf die Haut, für eine Sensibilisierung der Haut sowie für eine Reizung der Augen und der Atemwege. Mit dem Gefahrenpiktogramm Umwelt (GHS-Symbol GHS09) ist die Druckflüssigkeit ebenfalls gekennzeichnet. Es bedeutet, dass das Material gewässergefährdend ist.
Dermale Gefährdung (Gefährdung der Haut)
Im Sicherheitsdatenblatt der Druckflüssigkeit ist der H-Satz H317 zu lesen: „Kann allergische Hautreaktionen verursachen.“ Demnach kann es beim Kontakt von Resin mit der Haut zu einer allergischen Reaktion, einem allergischen Kontaktekzem, kommen. In manchen Fällen kann sich daraus auch eine Allergie entwickeln. Da das Gerät beim Drucken ein geschlossenes System ist, kann kein Kontakt mit der Haut stattfinden. Dies ändert sich jedoch beim Entnehmen des Druckobjekts, bei der Reinigung des Druckraums und beim Filtern des Kunstharzes. Auch die Entfernung eines Fehldrucks kann zum Hautkontakt führen, ebenso das Umfüllen der Kartuschen. Als persönliche Schutzmaßnahme sind Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk als Einmalhandschuh kurzzeitig zu tragen.
Dermale Gefährdung von Familienangehörigen
Wann härtet eigentlich das flüssige Resin aus, wenn es beispielsweise versehentlich über die Hose geschüttet wurde? Tatsächlich ist das erst der Fall, wenn es UV-Licht ausgesetzt wird; es härtet also zunächst nicht aus. Gibt man die Hose dann in die heimische Waschmaschine zum Waschen, wird das Resin teilweise ausgewaschen und verteilt sich durch Verschleppung in der Waschmaschine auf die Wäsche der nächsten Waschgänge. Um Familien- oder Haushaltsangehörige vor Hautreizungen zu schützen, darf kontaminierte Kleidung nicht zu Hause gewaschen werden. Als Schutzmaßnahme kann es sinnvoll sein, für Tätigkeiten wie das Um- oder Einfüllen von Kunstharz in die Druckwanne besondere Schutzkleidung zu tragen. Dies kann auch eine einfache Schürze bzw. Einwegschürze sein.
Gefährdung der Augen
Im Sicherheitsdatenblatt der Druckflüssigkeit ist weiterhin der H-Satz H319 zu lesen: „Verursacht ernsthafte Augenreizung.“ Wie klebrig sich das Material im Auge verhält, ist zu erahnen, wenn man im Sicherheitsdatenblatt unter dem Punkt „Erste Hilfe“ nachliest. Dort steht: Nach Augenkontakt 15 Minuten lang mit reichlich langsam fließendem, lauwarmem Wasser abspülen. Deshalb ist der Kontakt von Resin mit dem Auge zu verhindern. Als persönliche Schutzausrüstung ist eine Schutzbrille zu tragen.
Gefährdung der Umwelt
Der H-Satz H411 ist ebenso im Sicherheitsdatenblatt der Druckflüssigkeit enthalten: „Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.“ Das bedeutet, dass das Material nicht in das Abwasser gelangen darf. Dies ist bei wasserbasierten 3D-Druck-Waschmitteln ein wichtiger Punkt. Hersteller weisen auf Nachfrage auch auf diesen Umstand hin. Für den Fall, dass eine größere Menge Kunstharz verschüttet wird, ist Tonerde oder Kieselgur als Bindemittel vorzuhalten.
Isopropanol (IPA)
Bei Isopropanol handelt es sich um Alkohol, der auch Isopropylalkohol genannt wird. Besonders bei den Spülanlagen kommen große Mengen an Isopropanol zum Einsatz – in einigen Geräten sind das über 20 Liter! Aufgrund der damit verbundenen Gefahren ist es jedoch sinnvoll, die Menge so gering wie möglich zu halten. IPA ist ein Gefahrstoff und mit folgenden Piktogrammen sowie dem Signalwort Gefahr gekennzeichnet:
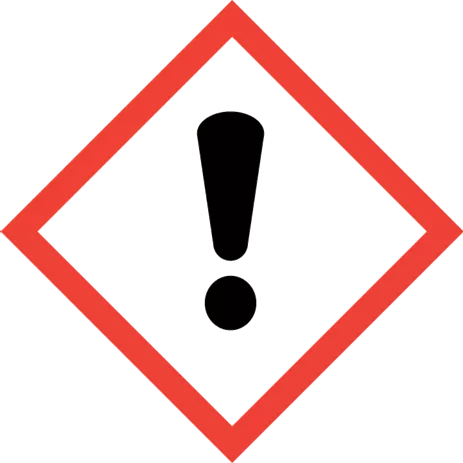
Das Ausrufezeichen steht wieder für eine Reizwirkung auf die Haut, für eine Sensibilisierung der Haut sowie für die Reizung von Augen und Atemwegen.
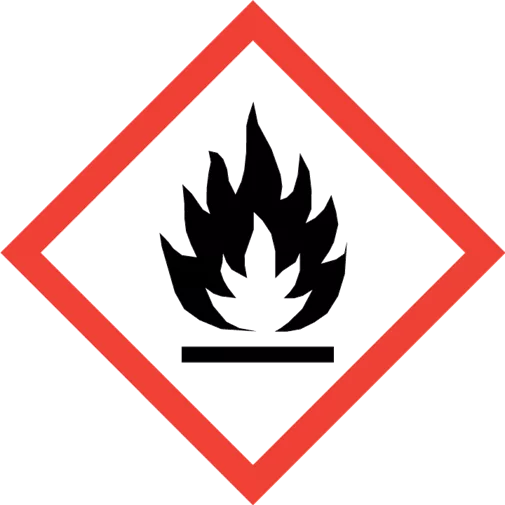
Die Flamme (GHS-Symbol GHS02) kennzeichnet unter anderem entzündbare Flüssigkeiten, Gase und Feststoffe.
Gefährdung durch Dämpfe
Da die 3D-gedruckten Objekte nach dem Spülen bzw. Waschen mit IPA abtropfen und an der Luft trocknen, kommt es zur Verdunstung von Isopropanol. Das betrifft sowohl die manuelle Reinigung als auch die im Reinigungsgerät (Washer). Die Dämpfe gehen in die Atemluft über.
Der Arbeitsplatzgrenzwert liegt bei 200 Millilitern pro Kubikmeter und ist gemäß TRGS 900 einzuhalten (TRGS = Technische Regel für Gefahrstoffe). Unter bestimmten Bedingungen kann sich sogar eine explosionsfähige Atmosphäre entwickeln. Sie entsteht bei mehr als zwei Volumenprozent IPA in der Luft. Diese zwei Prozent werden bereits erreicht, wenn ein Taschentuch mit 20 Millilitern IPA getränkt ist und in einen Behälter mit 10 Litern Fassungsvermögen gelegt wird. Bei schlechter oder fehlender Lüftung des Raumes könnte das auch im Dentallabor erreicht werden!
Bei der Verwendung von Isopropanol als Waschmittel ist zu beachten:
- Für ausreichend Belüftung sorgen.
- Deckel des IPA-Behälters bei Nichtgebrauch geschlossen halten.
- Zündquellen wie Bunsenbrenner, aber auch heiße Oberflächen (Vorwärmeofen, Keramikofen, Sinterofen, Gussschleuder) von diesem Bereich fernhalten.
- Auf Sauberkeit am Arbeitsplatz achten.
- Isopropanol auf die notwendige Menge begrenzen.
- Verspritzen vermeiden.
- Beim Befüllen sowie Entleeren des Waschbehälters ist eine Siphonpumpe zu verwenden. Sie schützt vor Überfüllung und weitgehend auch vor Spritzern. Bei dieser Tätigkeit Schutzbrille und Nitrilhandschuhe tragen.
Bei der Lagerung von Isopropanol ist zu beachten:
- Weil IPA leicht entzündbar ist, ist die Aufbewahrung in einem Brandabschnitt gemäß TRGS 510 nur bis maximal 25,6 Liter (entspricht 20 kg) erlaubt. Bei größeren Mengen wird ein Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe benötigt.
- Nur in gekennzeichnete Behälter abfüllen – keine Lebensmittelbehältnisse (Verwechslungsgefahr)!
- Möglichst im Originalbehälter aufbewahren. Es sind nur unzerbrechliche Gefäße mit maximal 10 Liter Fassungsvermögen zu verwenden. Auf eine entsprechende Kennzeichnung ist zu achten.
- Nicht auf Verkehrswegen, zum Beispiel im Treppenraum, und nicht in Sozialräumen lagern.
- Am Lagerort dürfen sich keine Zünd- und Wärmequellen befinden.
- Vor Überhitzung/Erwärmung, zum Beispiel Sonneneinstrahlung, schützen.
- Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Bei der Entsorgung von Isopropanol ist zu beachten:
- Da IPA als Gefahrstoff eingestuft ist, bedarf es einer speziellen Entsorgung. Verbrauchtes IPA hat bei seinem Einsatz einen Anteil von nicht ausgehärtetem Kunstharz aufgenommen!
- Die lokalen Entsorgungsvorschriften sind zu beachten. Mittlerweile gibt es auch Firmen, die die Entsorgung als Dienstleistung anbieten.
Nachhärtung
Die Nachhärtung der 3D-gedruckten Objekte erfolgt in einer Nachhärtungskammer (Lichthärtegerät) mit Licht und mit Wärme. Es gelten dieselben Anforderungen an den Aufstellort des Lichthärtegerätes wie beim 3D-Drucker, siehe oben.
Gefährdung durch heiße Oberflächen
Durch das Heizelement im Inneren des Lichthärtegerätes können Oberflächen innen und außen heiß werden. Daher ist Folgendes zu beachten:
- Die 3D-Objekte müssen vollständig getrocknet sein, um während des Nachhärteprozesses eine Entzündung durch eventuell noch vorhandenes IPA zu vermeiden.
- Beim Reinigen des Lichthärtegerätes mit IPA darf das Gerät nur noch maximal handwarm sein.
- Das gesamte IPA im Gerät muss abgetrocknet sein, bevor der nächste Nachhärtezyklus gestartet wird.
Weitere Maßnahmen
Auch im Bereich des 3D-Drucks sind die allgemeinen Aufgaben im Arbeitsschutz zu erledigen:
- Aufnehmen der Tätigkeiten in die Gefährdungsbeurteilung.
- Eintragen der Gefahrstoffe in das Gefahrstoffverzeichnis. Grundlage ist das jeweilige Sicherheitsdatenblatt.
- Erstellen der sich daraus ergebenden Betriebsanweisungen.
- Unterweisen der Beschäftigten.
Fazit
Integrieren Sie den Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in Ihre Ablaufprozesse beim 3D-Druck. Beziehen Sie bei Kaufentscheidungen für neue Geräte immer den Aspekt der Arbeitssicherheit mit ein.
 Entdecke CME Artikel
Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download
Entdecke Artikel mit Download 






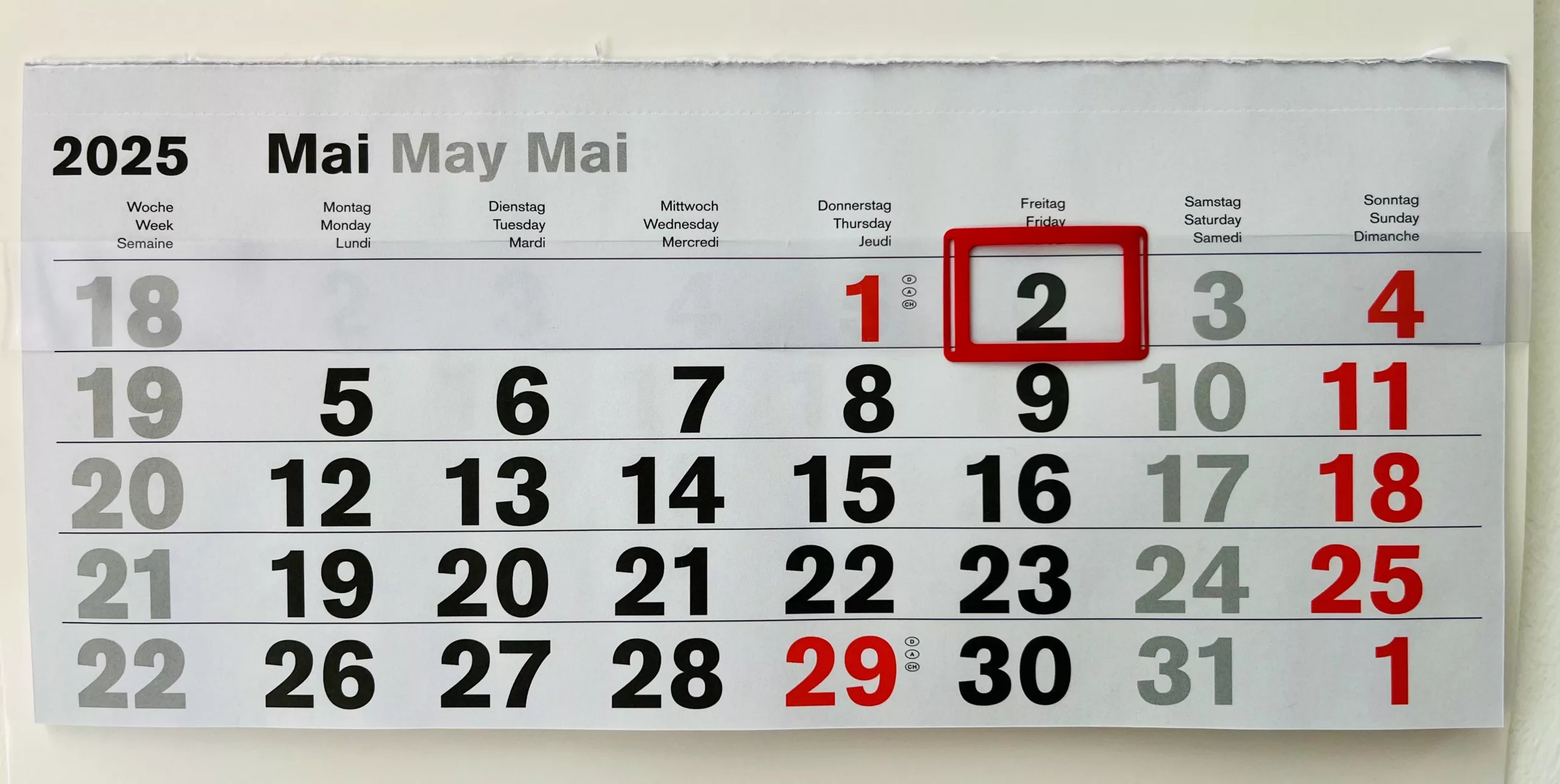
 Mit Google einloggen
Mit Google einloggen
 Mit Facebook einloggen
Mit Facebook einloggen
Keine Kommentare.