|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Ziel eines CMS ist die Sicherstellung der Regelkonformität im Unternehmen. Es umfasst sowohl die systematische Dokumentation von getroffenen Maßnahmen als auch interne Kontrollmechanismen. Vor diesem Hintergrund stellt sich für Zahnarztpraxen die berechtigte Frage: Ist ein CMS angesichts des erklärten Ziels einer Entbürokratisierung noch zeitgemäß?
Bürokratieabbau und CMS – ein Widerspruch?
Während Compliance auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und interner Richtlinien abzielt, bedeutet Entbürokratisierung die Vereinfachung administrativer Abläufe – oft durch den Abbau unnötiger Vorschriften. Auf den ersten Blick mögen sich diese Ziele widersprechen. Bei genauer Betrachtung ergibt sich jedoch ein ergänzendes Verhältnis: Je mehr Regelungen bestehen, desto mehr muss auf deren Einhaltung geachtet werden. Werden unnötige Regelungsbereiche jedoch abgebaut, hat auch ein CMS weniger zu tun. Es besteht also nicht zwangsläufig ein Widerspruch zwischen der Notwendigkeit eines CMS und dem Ziel des Bürokratieabbaus. Das Ziel, das ein CMS verfolgt, kann unabhängig hiervon erreicht werden. Ein CMS ist kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug zur Risikominimierung.
Es schützt Unternehmen vor Rechtsverstößen, finanziellen Sanktionen und Reputationsverlust. Zudem kann ein gut implementiertes CMS die betriebliche Effizienz fördern – etwa durch standardisierte Abläufe und klar definierte Verantwortlichkeiten. Damit wird das CMS zu einem strategischen Instrument für zukunftsorientierte Unternehmensführung – auch in der Zahnarztpraxis.
Strategischer Vorteil
Für Zahnarztpraxen besteht keine gesetzliche Pflicht zur Einführung eines CMS. Dennoch ist die Implementierung empfehlenswert – gerade in einem so hochregulierten und haftungssensiblen Umfeld wie dem Gesundheitswesen. Ein CMS dient nicht nur der rechtlichen Absicherung, sondern kann auch helfen, interne Abläufe zu optimieren und nachhaltig zu professionalisieren. Eine Orientierung bietet die Compliance-Leitlinie der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) aus dem Jahr 2015. Sie fasst vertragszahnärztliche Pflichten zusammen – ohne jedoch Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxisorganisation zu machen. Solche Leitlinien liefern Anhaltspunkte, die dabei helfen, das Thema Compliance richtig anzugehen.
Umsetzung mit Augenmaß
Beim Aufbau eines CMS sollte auch und gerade in Zahnarztpraxen auf Augenmaß gesetzt werden. Ein CMS muss dem Unternehmensalltag dienen und soll ihn nicht zusätzlich belasten. Daher sind hier nicht die gleichen Strukturen notwendig wie beispielsweise bei einem international agierenden Konzern. Ein zu bürokratisches System kann sogar einen gegenteiligen Effekt erzielen und Umgehungsstrategien fördern [2]. Compliance-Vorgaben sollten praxisnah, verständlich und verhältnismäßig sein – orientiert an den realen Risiken und Anforderungen der konkreten Zahnarztpraxis. Als Maßstab empfiehlt sich hier: so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Compliance-Themen in der Zahnarztpraxis
• Praxisorganisation
Zuerst muss grundlegend sichergestellt werden, dass in der Zahnarztpraxis sämtliche allgemeine Unternehmenspflichten eingehalten werden – etwa im Arbeitsrecht (z. B. Arbeitsschutz, Mindestlohn) oder im Bereich der steuerlichen Compliance („Tax-Compliance“). Auch dem Datenschutz kommt hier besondere Bedeutung zu – nicht zuletzt, weil mit sensiblen Gesundheitsdaten gearbeitet wird. So sollten beispielsweise personenbezogene Patientendaten nicht unverschlüsselt per E-Mail oder (soweit noch vorhanden) per Fax übermittelt werden. Ebenso ist auf die Einhaltung von Löschfristen nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen zu achten. Darüber hinaus besteht eine Vielzahl an spezifischen Berufs- und Vertragszahnarztpflichten. Trotz des avisierten Bürokratieabbaus sind diese in den letzten Jahren nicht weniger geworden, sondern haben eher zugenommen. Zu nennen ist hier bspw. der Bereich der Telematik, der auch für die Praxisorganisation einige Vorgaben mit sich bringt, auf deren Einhaltung zu achten ist. Beispielhaft zu nennen ist die Durchführung des sog. Versichertenstammdatenabgleichs: Erfolgt dieser nicht, z.B. auf Grund einer Nichtanbindung an die Telematikinfrastruktur oder wegen technischer Probleme, die nicht behoben werden, sind Honorarkürzungen die Folge.
Ein weiteres aktuelles Beispiel für die praktische Relevanz von Compliance ist die Einführung der E-Rechnung. Zwar bedeutet die Umsetzung zunächst organisatorischen Mehraufwand, langfristig lassen sich aber Abläufe effizienter gestalten, Fehler reduzieren und Ressourcen einsparen. Wichtig: Auch wenn Zahnarztpraxen derzeit nicht verpflichtet sind, E-Rechnungen zu versenden, müssen sie in der Lage sein, diese zu empfangen. Ist dies technisch nicht möglich, gilt die Rechnung dennoch als gestellt, Zahlungsverzug tritt ein und Reputationsschäden können drohen. Nicht zuletzt unterliegt auch der eigentliche Tätigkeitsbereich – die zahnärztliche Behandlung – strengen regulatorischen Anforderungen, z.B. im Hygienebereich, dem Röntgen etc. In all diesen Bereichen kann ein CMS dazu genutzt werden, die Einhaltung der Vorgaben sicherzustellen.
• Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern
Ein zentraler Aspekt der Compliance betrifft die Geschäftsbeziehungen – bei einer Zahnarztpraxis z.B. die zu Dentallaboren oder dem Dentalfachhandel. Für deren Bewertung sind vier Prinzipien von besonderer Bedeutung:
- Nach dem Trennungsprinzip dürfen Zuwendungen nicht mit Beschaffungsentscheidungen verknüpft werden.
- Das Transparenzprinzip fordert, alle Zuwendungen und Vergütungen offen zu legen.
- Aus dem Äquivalenzprinzip folgt, dass Leistung und Gegenleistung in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen sollen. Ein Ungleichgewicht kann darauf hindeuten, dass mit der entsprechenden Leistung (auch) etwas anderes verfolgt wird.
- Alle Leistungen sollten schriftlich fixiert werden (Dokumentationsprinzip).
Im Bereich der zahntechnischen Leistungen ist vor allem ein Bereich unter Compliance-Gesichtspunkten interessant: die Preisgestaltung. Denn Zahnarztpraxen unterliegen hier Vorgaben zur Abrechnung gegenüber Patientinnen und Patienten. Sie dürfen nach § 9 Abs. 1 der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) nur die tatsächlich entstandenen angemessenen Kosten der zahntechnischen Leistungen berechnen. Rabatte dürfen daher nicht zur eigenen Gewinnerzielung einbehalten, sondern müssen weitergegeben werden. Das bedeutet auch, dass eine Zahnarztpraxis von einem eingeräumten Rabatt ggf. gar nicht selbst profitiert. Lediglich übliche Skonti (2–3% bei Zahlungsziel bis 14 Tage) dürfen in zulässiger Weise einbehalten werden.
Eine Vertragsvereinbarung, die diese Grundsätze zu unterlaufen versucht, ist rechtlich unzulässig. Dem Transparenzprinzip folgend sollten Rabatte klar ausgewiesen werden. Denn dann können diese auch den rechtlichen Vorgaben entsprechend weitergegeben werden. Wird ein solcher Rabatt „versteckt“, kann dies als ein erster Hinweis darauf verstanden werden, dass eine Rabattweitergabe umgangen werden soll. Ein Verstoß gegen die o.g. Vorgabe kann etwa zur Nichtigkeit des getroffenen Vertragsabschlusses führen. Sogar eine strafrechtliche Verantwortung kann im schlimmsten Fall – neben disziplinar-, zulassungs- oder berufsrechtlichen Konsequenzen – in Betracht kommen.
Nur dort, wo Materialkosten pauschaliert in den zahnärztlichen Gebührenziffern schon mitberücksichtigt werden, wie beispielsweise bei Brackets, kann ein Rabatt behalten werden. Eine weitere Besonderheit ergibt sich darüber hinaus bei Edelmetalllegierungen. Diese werden üblicherweise zu einem tagesaktuellen Kurs bezogen, der sich vom Preis am Tag der Verarbeitung unterscheiden kann. Hier ist es anerkannt, dass für die Abrechnung der jeweilige Tagespreis am Tag der Leistungserbringung zugrunde gelegt werden darf. Kursgewinne, die durch einen niedrigeren Einkaufspreis entstehen, verbleiben in diesem Fall bei der Zahnarztpraxis – allerdings müssen ebenso Kursverluste getragen werden.
Beispiel: Partner-Factoring
Ein anschauliches Beispiel für einen potenziellen Compliance-Verstoß stellt das sogenannte Partner-Factoring dar. Dieses ist zwischenzeitlich weitestgehend vom Markt verschwunden – und das nicht ohne Grund; an den dargestellten Compliance-Prinzipien lässt sich erkennen, warum. Bei dem Partner-Factoring beteiligt sich das Dentallabor an den Kosten, die einer Zahnarztpraxis für die Abtretung ihrer Forderung gegenüber einer Patientin bzw. einem Patienten entstehen – und zwar bezogen auf den Forderungsteil für die zahntechnischen Leistungen. Allerdings ist das Labor kein Vertragspartner der Patientin bzw. des Patienten, sondern nur der Zahnarztpraxis. Deshalb erhält es von der Zahnarztpraxis die vereinbarte Vergütung auch dann, wenn die Rechnung von Patientenseite nicht beglichen wird.
Das Labor profitiert also selbst nicht von dem Factoring, eine Beteiligung an den Kosten stellt sich deshalb als eine Art Bezuschussung der Zahnarztpraxis dar. Mangels Gegenleistung liegt deshalb ein Verstoß gegen das Äquivalenzprinzip vor. Das Trennungsprinzip wird hier verletzt, da mit der Bezuschussung in der Regel verfolgt wird, weitere Aufträge von der Zahnarztpraxis zu erhalten, also auf deren Beschaffungsentscheidung Einfluss zu nehmen. Häufig fehlte auch die Offenlegung der Leistung (Verstoß gegen das Transparenzprinzip).
Die genannten Compliance-Prinzipien führen somit zu einer Bewertung dieser Kooperation als kritisch. Das rechtliche Problem, das hier dahintersteckt, ist folgendes: Da die Zahnarztpraxis nur die tatsächlich entstandenen Kosten weiterberechnen darf (s.o.) und die Bezuschussung für das Factoring die tatsächlichen Kosten der Praxis mindert, muss dieser Betrag weitergegeben werden.
Ansonsten ist die zahnärztliche Rechnungsstellung unrichtig. Wenn dieser Zusammenhang auch Gegenstand der Absprache war, kann neben einem Abrechnungsbetrug sogar eine Korruption nach § 299a f. StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen) in Betracht kommen.
Beispiel: Heilmittelwerberecht
An die zuvor dargestellten rechtlichen Rahmenbedingungen knüpft ein weiteres praxisrelevantes Problem mit Compliance-Relevanz an: die Frage, wie erhaltene Rabatte im Rahmen der Abrechnung ggf. weiterzugeben sind. Besteht der Rabatt in einem Geldbetrag, lässt sich dieser in der Regel unkompliziert auf der Rechnung ausweisen und an die Patientin oder den Patienten weitergeben. Komplexer wird es jedoch bei Naturalrabatten, etwa bei einer Bezugsvereinbarung nach dem Prinzip „12 Implantate zum Preis von 10“. Da laut GOZ ausschließlich die tatsächlich entstandenen Kosten abgerechnet werden dürfen, kann in diesem Fall nicht der volle Preis für alle 12 Implantate berechnet werden.
Die Zahnarztpraxis würde dadurch mehr für die Implantate erhalten, als sie bezahlt hat. Eine praktikable Lösung besteht darin, den Gesamtpreis auf die erhaltene Stückzahl umzulegen und so einen Durchschnittspreis pro Implantat zu ermitteln (d.h. 1/12 des Gesamtbetrags). Diese Methode setzt jedoch eine präzise Dokumentation voraus. Es muss nachvollziehbar sein, welches Implantat zu welchem Einkaufspreis bezogen wurde – was in der Praxis organisatorische und logistische Anforderungen an das Praxismanagement stellt. Ein funktionierendes CMS in der Zahnarztpraxis sollte dazu beitragen, dass die Besonderheiten bei der Abrechnung für zahntechnische Leistungen und Medizinprodukte berücksichtigt werden. Dies vermeidet Regresse, Reputationsschäden sowie berufs- als auch im schlimmsten Fall strafrechtliche Konsequenzen.
Beispiel: Beteiligungen an Dentallaboren
Als letztes Beispiel für die Bedeutung eines CMS soll die Beteiligung an Dentallaboren dienen. Für Zahnarztpraxen spielt naturgemäß die Zusammenarbeit mit einem Dentallabor eine wichtige Rolle – sei es im Rahmen ständiger Geschäftsbeziehung, durch eine Mitbetreibung oder auch eine bloße Gewinnbeteiligung. Sollen zahntechnische Leistungen selbst hergestellt werden, ist zwischen einem Eigenlabor und einem Gewerbelabor zu unterscheiden.
Das Eigenlabor dient ausschließlich der Versorgung der eigenen Patientinnen und Patienten. Bei der Abrechnung sind die Eigenlaborpreise in Ansatz zu bringen. Sollen jedoch auch externe Patientinnen und Patienten versorgt werden, liegt ein Gewerbelabor vor – mit entsprechend anderen Implikationen. Probleme kann dies aufwerfen, wenn das Gewerbelabor (auch) Arbeiten für die eigenen Patientinnen und Patienten anfertigt.
In Frage steht hier z.B., ob dann mit der Beteiligung an dem Gewinn des Labors gegen das Zuweisungsverbot verstoßen werden kann. Dahinter steht der Gedanke, dass die Erteilung des Auftrags an das (eigene) Gewerbelabor nur deshalb erfolgt, weil hiermit zusätzlich eine Gewinnbeteiligung einhergeht. Dies würde die medizinische Entscheidung, durch wen die Zahntechnik im Interesse einer optimalen zahnmedizinischen Versorgung anzufertigen ist, und ggf. auch den Wettbewerb beeinträchtigen. Beides ist vom Gesetzgeber nicht gewünscht.
Dem Bundesgerichtshof (BGH) zufolge hängt das Vorliegen eines Verstoßes gegen das Zuweisungsverbot auch von der Form der Gewinnbeteiligung ab. Je direkter diese ist, desto problematischer ist sie einzustufen. Das ist bspw. der Fall, wenn jede Auftragserteilung einen festgelegten Geldbetrag als Gewinn an dem Labor auslöst (z.B. für jeden Auftrag die Zahlung eines Geldbetrags X). Denn dann ist der Geldfluss als direkte Folge aus der Auftragserteilung spürbar. Für sog. indirekte Gewinnbeteiligungen hat der BGH demgegenüber weitere Beurteilungskriterien bestimmt: Eine Spürbarkeit der Zuweisung bzw. Auftragsvergabe richtet sich im Einzelfall nach dem Gesamtumsatz des Unternehmens, dem Anteil der Verweisungen und der Höhe der Beteiligung [4]. Dies zeigt, wie kompliziert solche Fallkonstellationen in der Bewertung sein können.
Auch wenn ein CMS schon deshalb keine ganz konkreten Antworten geben kann – höchstrichterlich ist hier ohnehin noch nicht alles geklärt –, kann es dabei helfen, risikobehaftete Konstellationen zu erkennen, was in die Lage versetzt, sich der Risiken bewusst zu werden und ggf. rechtlichen Rat einzuholen. Die Compliance-Prinzipien identifizieren diese Konstellationen dadurch als potentielles Risiko, dass die Gewinnbeteiligung sich wie gesehen nicht gänzlich von der Beschaffungsentscheidung trennen lässt (Trennungsprinzip) und in der Regel gegenüber Betroffenen (hier Patientinnen und Patienten) nicht offen gelegt wird (Transparenzprinzip). Das Äquivalenzprinzip kann ebenfalls einen Anhaltspunkt geben, nämlich wenn der Gewinnbeteiligung keine Leistung gegenübersteht. Dies wäre etwa der Fall, wenn diese ausschließlich dazu dient, eine weitere Auftragsvergabe an das Labor sicherzustellen.
Fazit
Auch in Zeiten des Bürokratieabbaus bleibt ein CMS für Zahnarztpraxen ein sinnvolles Instrument. Es schafft Klarheit, reduziert rechtliche Risiken und unterstützt effiziente Abläufe. Ein CMS hilft, Risiken zu erkennen und regelkonforme Lösungen zu etablieren. Damit wird es zu einem wichtigen Baustein für rechtssicheres und zukunftsfähiges Wirtschaften in der Zahnarztpraxis.
 Entdecke CME Artikel
Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download
Entdecke Artikel mit Download 
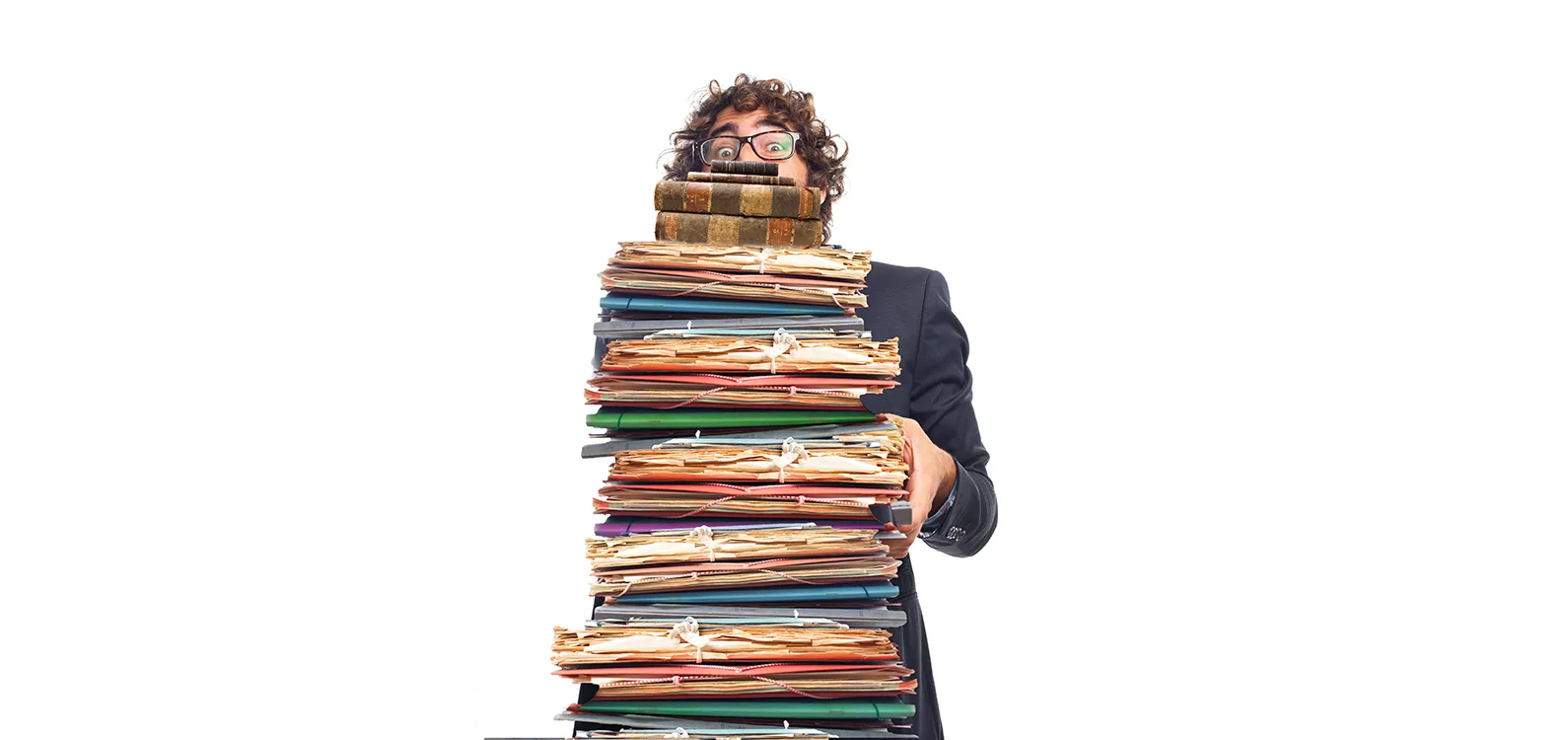

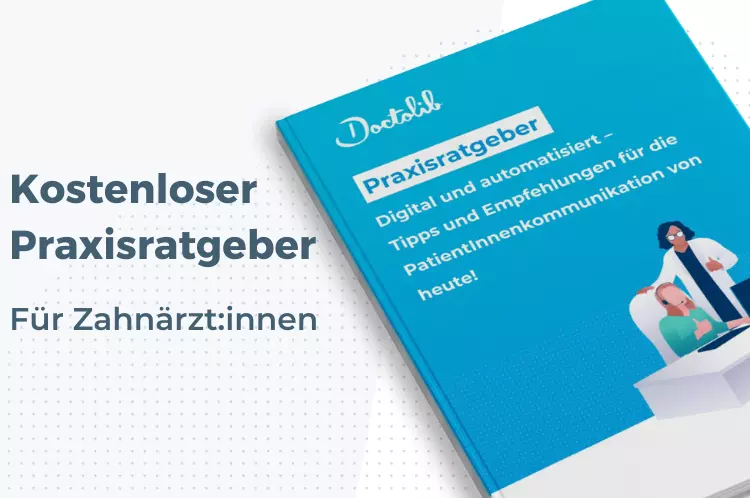




 Mit Google einloggen
Mit Google einloggen
 Mit Facebook einloggen
Mit Facebook einloggen
Keine Kommentare.