Häufig werden unter dem Sammelbegriff TMD zahlreiche z.T. auch unspezifische Beschwerdebilder eingeordnet, die sich nicht eindeutig den klassischen zahnärztlichen Disziplinen zuordnen lassen. Im internationalen Kontext gibt es jedoch den Konsens, dass die Kaumuskulatur und/oder die Kiefergelenke reproduzierbar pathologische Symptome (Druckdolenzen, Gelenkgeräusche oder Bewegungseinschränkungen) aufweisen müssen, um eine TMD-Diagnose zu rechtfertigen. Auf dieser Basis in Kombination mit den internationalen Anstrengungen zu einer standardisierten Diagnostik wurden zahlreiche Studien zur Diagnostik, Ätiologie, Therapie und Prognose von muskulären, gelenkspezifischen Erkrankungen und Mischformen publiziert. Der zweiteilige Artikel soll einen Überblick über die interessantesten im Jahr 2015 publizierten klinischen Studien geben.
Diagnosestandard
Im Jahr 2002 wurde ein internationales Netzwerk unter dem Dach der International Association for Dental Research (IADR) gegründet, mit dem Ziel, einen international vergleichbaren Diagnosestandard zu etablieren. Die Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RCD/TMD von Dworkin, LeResche et al.) beschreiben präzise ein klinisches Untersuchungsprotokoll, aus dem physische Diagnosen abgeleitet und auf der sogenannten Achse I erfasst werden, getrennt von den subjektiven Beeinträchtigungen, die der Achse II zugeordnet sind. Auf der Basis klinischer Befunde, aber auch zusätzlicher MRT-Aufnahmen, können muskuläre Beschwerden und zwei Gruppen von kiefergelenkspezifischen Diagnosen unterschieden werden:
I Muskuläre Erkrankungen
- Myofaszialer Schmerz mit Bewegungseinschränkungen
- Myofaszialer Schmerz ohne Bewegungseinschränkung
II Diskusverlagerungen
- Diskusverlagerung mit Reposition
- Diskusverlagerung ohne Reposition ohne Bewegungseinschränkung
3 Diskusverlagerung ohne Reposition mit Bewegungseinschränkung
III Gruppe 3
- Arthralgie
- Arthritis
- Arthrose
Dieser überwiegend auf klinische Befunde gestützte Diagnosestandard setzt sich in der klinischen Forschung immer mehr durch und verdrängt andere, veraltete Systematiken wie z. B. den Helkimo-Index. Inwieweit der inzwischen erweiterte Diagnosestandard DC/TMD die RDC/TMD ersetzen wird, bleibt aufgrund der Komplexität und der zahlreichen zusätzlichen Diagnosen abzuwarten.
Vilanova et al. [1] untersuchten, inwieweit sich die klinische Untersuchungstechnik und Diagnosestellung der DC/TMD auch durch Selbstinstruktion unter Verwendung eines Lehrvideos erlernen lassen. Für die meisten Diagnosen wurden akzeptable Übereinstimmungen gefunden, die sich durch ein zweitägiges Kalibrierungstraining jedoch noch deutlich steigern ließen.
Kommentar: Als gemeinsame Basis für die klinische Forschung, aber auch zur Nutzung aktueller Studienresultate für die Diagnostik und Therapie in der zahnärztlichen Praxis im Sinne einer evidenzbasierten Funktionstherapie sind die RDC/TMD inzwischen der etablierte Standard, der von den meisten Forschungsgruppen zur Charakterisierung ihres Untersuchungsgutes benutzt wird.
Bildgebende Verfahren
DVT
In einem Review gingen Larheim et al. [5] der Frage nach, inwieweit DVTs zur Diagnostik von Osteoarthritis, rheumatischer Arthritis oder anderen Formen spezifischer Kiefergelenkerkrankungen geeignet sind. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass DVTs konventionellen Röntgenaufnahmen überlegen sind, sich die Darstellung aber auf knöcherne Strukturen beschränkt. Für die Beurteilung des kortikalen Knochens kann das DVT das CT ersetzen. Letztendlich bemängeln die Autoren ein Defizit an Studien, die einen therapeutischen Nutzen des DVTs belegen. Zum sicheren Nachweis von gelenkspezifischen TMD-Formen mit Diskusverlagerungen bleiben MRTAufnahmen unverzichtbar (Abb. 1).![Abb. 1: DVT einer 13-Jährigen (oben) ohne Kompakta an der oberen Kondyluskontur und homogene Darstellung der Corticalis am Kondylus bei einer 69-Jährigen [5].](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/post_images/Abb.01_2a582b.jpg.webp)
![Abb. 2: Versuch einer Klassifizierung von knöchernen Formveränderungen des Kondylus im DVT [6].](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/post_images/Abb.02_86e604.jpg.webp)
Gomez et al. [6] werteten DVT-Aufnahmen von 84 Patienten aus, mit dem Ziel, die dreidimensionalen Formveränderungen des Kondylus bei Osteoarthritis mit einem komplexen statistischen Clusterverfahren zu klassifizieren. Wie zu erwarten, wurden aufgrund der Patientenauswahl signifikante Unterschiede im Vergleich zu einer Kontrollgruppe von sieben gesunden Probanden gefunden (Abb. 2).
MRT
Die Magnetresonanztomografie (MRT) ist der Goldstandard zum Nachweis von Diskusverlagerungen im Kiefergelenk. DeMelo et al. [7] untersuchten Zusammenhänge zwischen dem Grad der Diskusverlagerung und dem Auftreten von Schmerzen und von knöchernen Veränderungen an 102 jungen Patienten unter 21 Jahren. Von Patienten ohne Diskusverlagerung über Patienten mit ADV mit Reposition bis zu Diskusverlagerungen ohne Reposition nahm die Häufigkeit von knöchernen Veränderungen deutlich zu. Bei deutlicher Zunahme von knöchernen Veränderungen des Kondylus mit fortschreitender Diskusverlagerung in beiden Kiefergelenken gab es keine signifikante Korrelation zu Schmerzangaben [7].
EMG
Der diagnostische Wert der Oberflächen-Elektromyografie (EMG) ist bisher unklar. Berni et al. [8] verglichen Oberflächen-EMGs von 80 Frauen mit der Diagnose myofaszialer Schmerz (nach RDC/TMD) mit den Aufzeichnungen von 43 symptomfreien Frauen. Gemessen wurden die Ruheaktivität und die Aktivität beim Pressen mit maximaler Kraft am M. temporalis anterior, M. masseter und der suprahyoidalen Muskulatur. Die Ruheaktivität aller gemessenen Muskeln fiel im Durchschnitt bei myofaszialen Schmerzen signifikant höher aus. Dagegen unterschieden sich die Aktivitäten bei maximaler Kontraktion selten. Bei geschickter Wahl der Trennpunkte (Cut-off-Values) und Verwendung der Ruheaktivität kann eine Sensitivität und Spezifität zur Unterscheidung von Gesunden und Patienten mit myofaszialen Schmerzen von ca. 70 % erreicht werden. Die Ruheaktivität verschiedener Kaumuskeln (in dieser Untersuchung: M. temporalis links, M. masseter links, M. temporalis rechts, suprahyoidale Muskulatur) eignet sich nach diesen Ergebnissen also zur diagnostischen Trennung von myofaszialem Schmerz und gesunden Kontrollen. Die Aktivität bei maximaler willkürlicher Kontraktion ist dagegen diagnostisch ungeeignet [8].
Biomarker
Ceusters et al. [9] beschreiben in einem Review die Perspektiven, orofaziale Schmerzen künftig anhand von Biomarkern weitergehend zu diagnostizieren. Dabei werden drei Typen von Markern näher beleuchtet:
- physiologische Messungen, wie z. B. Druckschmerzschwellen, QST etc.
- genetische Faktoren, die über Zytokine wirksam werden
- bildgebende Marker, die mithilfe von fMRT oder PET isoliert werden
Komorbidität
Bruxismus
Bruxismus wird in der Praxis häufig in Zusammenhang mit TMD gebracht, ohne dass ein kausaler Zusammenhang belegt wäre. Bei Vorliegen von Schlifffacetten wird meist auf Bruxismus rückgeschlossen, der bei hartnäckigen Nachfragen auch von einigen Patienten bestätigt wird.
Der Nachweis von Schlafbruxismus stützte sich in den meisten Studien ausschließlich auf anamnestische Angaben (Self Report). Untersuchungen von 124 TMD-Patienten und 46 Kontrollpersonen im Schlaflabor von Raphael et al. [18] zeigten, dass anamnestische Angaben zum Schlafbruxismus im Vergleich zum Schlaflabor zu einer schlechten Trefferquote führen, die mit einer schlechten Sensitivität oder einer schlechten Spezifität verbunden sind. Der „Self Report“ scheint daher weder zum Nachweis noch zum Ausschluss von Schlafbruxismus geeignet zu sein. Die Autoren lehnen daher die üblichen Fragebögen zum Schlafbruxismus selbst als Screening-Instrument ab.
Jonsgar et al. [19] verwendeten das GrindCare-Gerät, um die nächtliche Muskelaktivität bei 16 jungen Erwachsenen mit 16 gematchten Probanden ohne ausgeprägte Attritionen der Zahnhartsubstanz zu vergleichen. Während Schlafbruxismus bei den Probanden mit ausgeprägter Attrition signifikant häufiger in der Anamnese angegeben wurde, unterschieden sich die verschiedenen Parameter der EMG-Aufzeichnungen zwischen den beiden Gruppen nicht. Die Autoren folgern daraus, dass der Rückschluss von Schlifffacetten auf Schlafbruxismus unzulässig ist.
Schmitter et al. [20] untersuchten mit dem GrindCare-Gerät die nächtliche Muskelaktivität des M. temporalis von 22 Frauen mit myofaszialem Schmerz und von 22 symptomfreien Kontrollpersonen. Frauen mit myofaszialem Schmerz zeigten vergleichsweise häufiger Zeichen von Schlafbruxismus und häufiger eine eingeschränkte Schlafqualität.
Kommentar: Bruxismus wurde in der Vergangenheit häufig als Ursache von TMD gesehen, wobei sich der Nachweis von Schlafbruxismus auf anamnestische Angaben stützte. Aufgrund der unzureichenden Zuverlässigkeit des sog. Self Reports für Schlafbruxismus müssen viele Studienergebnisse hierzu infrage gestellt werden. Vereinfachte elektromyografische Aufzeichnungen könnten die aufwendigen Untersuchungen im Schlaflabor, die als Goldstandard zum Nachweis von Schlafbruxismus gelten, u. U. ersetzen.
Mit der Behandlung des Schlafbruxismus befassten sich Manfredini et al. [21] in einem Review. Von 14 Studien mit akzeptablem diagnostischem Standard zeigten 7 Studien, dass verschiedene Aufbissbehelfe den Schlafbruxismus reduzieren können, wobei Schienen mit stärkerer Vorverlagerung des Unterkiefers etwas effektiver zu sein scheinen. Vier Studien belegen die Wirksamkeit verschiedener Pharmaka (Botulinumtoxin, Sedativa). Die Autoren empfehlen jedoch Zurückhaltung bei der Behandlung von Schlafbruxismus, da sie dem Phänomen der nächtlichen motorischen Aktivität keine zwingende pathologische Relevanz zumessen.
Kopfschmerzen
Dahan et al. [22] untersuchten die Häufigkeit von Migräne, chronischen Erschöpfungszuständen, Restless Legs etc. bei 180 TMD-Patienten aus Boston und Montreal. Dabei zeigte sich, dass die Schmerzintensität und die Schmerzdauer mit der Anzahl der Komorbiditäten signifikant anstiegen. Diese Zusammenhänge verschwanden bei isolierter Betrachtung von TMD-Patienten, die keine Diagnose myofaszialer Schmerzen aufwiesen.
Kommentar: Auch unter dem Gesichtspunkt der Ätiologie und der Komorbidität scheint die getrennte Analyse von muskulären TMD-Erkrankungen und gelenkspezifischen Diagnosen gerechtfertigt.
Speciali und Dach [23] gingen in einem Review der Komorbidität von TMD und primären Kopfschmerzen nach sowie dem sekundären TMD-bedingten Kopfschmerz, der bereits in die DC/TMD Eingang gefunden hat. Für Migräne, Spannungskopfschmerzen und chronische tägliche Kopfschmerzen finden die Autoren Belege für häufige Komorbiditäten mit TMD. Die Erklärung hierfür liegt in der Gemeinsamkeit von peripheren und zentralen Sensibilisierungen. Die Datenlage zum sekundären TMD-bedingten Kopfschmerz halten sie noch für unzureichend, um diesen Kopfschmerztyp eindeutig abgrenzen zu können.
Nackenschmerzen und muskuläre Probleme in anderen Körperregionen
Physiotherapeuten aus Brasilien (da Costa et al. [24]) verglichen die Häufigkeit von Einschränkungen der Nackenfunktion bei 27 Patienten mit Kaumuskelschmerzen und einer kleinen Kontrollgruppe (n = 28). Die Druckschmerzschwellen zeigten signifikante Korrelationen (r > 0,4) zwischen Kaumuskeln und Nackenmuskeln.
Saddu et al. [25] überprüften an 34 TMD-Patienten mit muskulären Schmerzen oder Diskusverlagerungen die Nackenund Kopfhaltung mithilfe von Röntgenaufnahmen und fotografisch im Vergleich zu 34 Kontrollen ohne TMD. Während die Kopfhaltung keinen Unterschied zwischen den drei Gruppen aufwies, zeigten seitliche Röntgenaufnahmen einen leicht vergrößerten Winkel der zervikalen Kurvatur der Halswirbelsäule bei myofaszialem Schmerz und eine geringfügig vergrößerte Atlas-Axis-Distanz bei Patienten mit Diskusverlagerung im Kiefergelenk.
Kommentar: Die Daten sprechen für eine häufige Komorbidität von Kaumuskelschmerzen und Nackenproblemen, ohne dass daraus kausale Zusammenhänge abzuleiten wären. Die klinische Relevanz geringfügiger Winkelunterschiede bei der Vermessung von Röntgenaufnahmen bleibt fraglich.
Für Schulterschmerzen im Bereich der Rotatorenmanschette und TMD nehmen Bonato et al. [26] eine gehäufte Komor bidität an. Inwieweit hier genetische Gemeinsamkeiten als Ursache infrage kommen, untersuchten sie an 16 Patienten mit Schulterschmerzen, 13 Patienten mit TMD, 49 Patienten mit TMD und Schulterschmerzen sowie an 30 Kontrollpersonen ohne Schmerzen. Die Wahrscheinlichkeit, Schulterprobleme aufzuweisen, war gegenüber der Kontrollgruppe bei TMD-Patienten siebenmal höher. Für einen bei der Regulation der Östrogenwirkung wichtigen ß-Rezeptor (ESRRB) trat bei Schulterschmerzen ein Genotyp von insgesamt acht Polymorphismen gehäuft auf, während TMD-Patienten einen anderen Genotyp besonders häufig aufwiesen. Patienten mit beiden Diagnosen wiesen wiederum andere Verteilungen auf.
| Teil zwei dieses Beitrags lesen Sie in der nächsten Ausgabe der ZMK. |
|---|
| Dieser Beitrag ist entnommen aus dem 2. ZMK-Update-Seminar vom 17. und 18. Juni 2016. |
|---|
Weiterführende Links
Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels
 Entdecke CME Artikel
Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download
Entdecke Artikel mit Download 

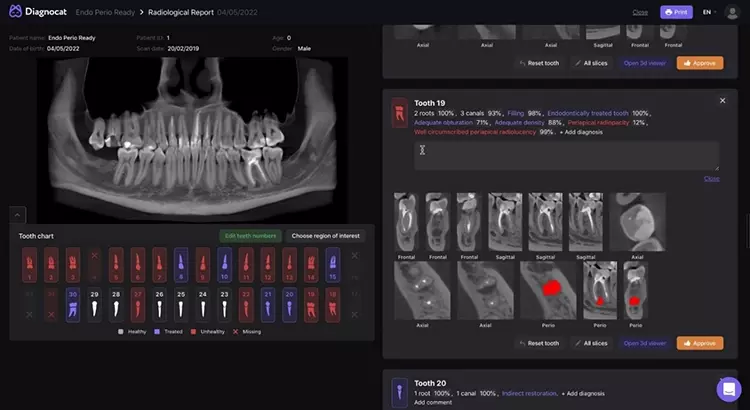
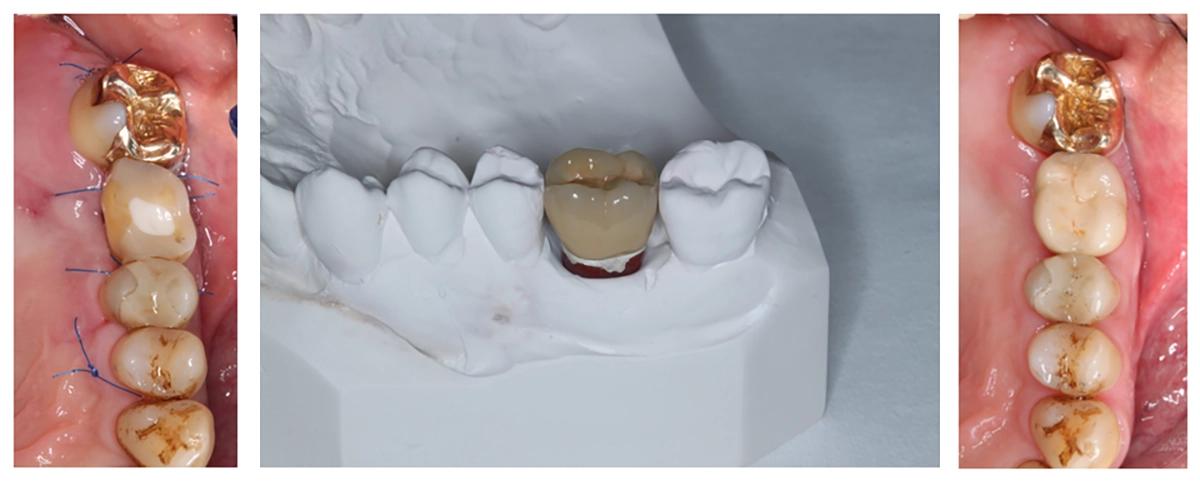

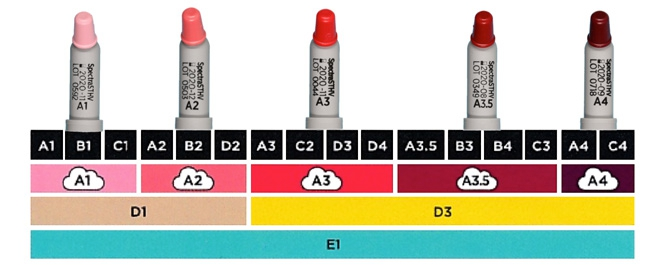

 Mit Google einloggen
Mit Google einloggen
 Mit Facebook einloggen
Mit Facebook einloggen
Keine Kommentare.