In ihren Studien hat Prof. Deinzer gezeigt, dass zahnmedizinische Laien oft nur über ungenügende Mundhygienefertigkeiten verfügen, also die Zähne beim Putzen nicht sauber werden. Dabei ist eine kompetente Entfernung des dentalen Biofilms insbesondere für die Prävention, Therapie und Stabilisierung von Parodontitis ein entscheidender Aspekt [1,2].
Frau Prof. Deinzer, auf dem DGKiZ-Jahreskongress 2023 haben Sie jüngere Forschungsergebnisse Ihrer Arbeitsgruppe zur Mundhygiene von Eltern und Kindern vorgestellt. Sie sagten, dass Sie die Vermeidung von Karies und parodontalen Erkrankungen gleichermaßen als Ziele des häuslichen Zähneputzens verstehen. Was bedeutet dies für das Zähneputzen?
Prof. Deinzer: Das bedeutet, dass man beim Zähneputzen von Anfang an den Fokus auch auf den Gingivarand legen soll, denn dieser Bereich muss plaquefrei bleiben, wenn man Parodontalerkrankungen vermeiden möchte. Es reicht nicht aus, nur die Kauflächen zu säubern, um Fissurenkaries zu vermeiden. Das ist zwar bei Kindern besonders wichtig, aber der Zahnfleischrand ist es auch und wird es später immer mehr. So lernen die Kinder, diesen auch gleich in die Mundhygiene mit einzubeziehen. Zumal es in der Regel schwer ist, am Gingivarand zu putzen, ohne die darüber liegende Krone auch zu säubern. Umgekehrt geht es aber schon: oberes Kronendrittel sauber und am Gingivarand noch Plaque. Dies ist offensichtlich ein weit verbreitetes Problem.
Sie empfehlen also gründliches Putzen von Anfang an?
Prof. Deinzer: Ich bin vorsichtig bei der Verwendung des Begriffs „gründlich“, da wir aus unserer Forschung gelernt haben, dass er unterschiedlich verstanden wird. Wenn ich jemandem sage, er solle gründlich putzen, denken Patienten möglicherweise daran, dass 3 Minuten Putzzeit besser sind als 2 Minuten. Wenn sie jedoch 2 oder 3 Minuten lang nur die obere rechte Seite putzen, ist es links unten immer noch nicht sauber. Daher sollte man bei der Verwendung dieses Begriffs vorsichtig sein.
Gut, wir müssen also sagen: die Zähne wirklich sauber putzen – im Sinne von „plaquefrei“. Darum ging es auch in Ihrem Vortrag. Dieser war mit dem Titel „Wenn Hans es nicht kann, wie lernt Hänschen es dann?“ überschrieben. Er impliziert, dass Eltern eine Vorbildfunktion beim Zähneputzen einnehmen sollten – diese aber oft nicht ausfüllen. Und er besagt auch, dass wir früh ansetzen sollten, um ein hohes Niveau häuslicher Mundhygiene zu erreichen. Gibt es ein bestimmtes „Zeitfenster“ für das Erlernen des Zähneputzens?
Prof. Deinzer: Ein wichtiger Aspekt davon, Kindern bereits früh die Zahnbürste in die Hand zu geben, ist, dass Zähneputzen ein Habit wird. Sie kennen das wahrscheinlich selbst: Man fühlt sich unwohl, wenn man sich nicht die Zähne geputzt hat. Irgendwie gehört es dazu, es ist eine Gewohnheit. Die Kinder sollten also früh an das Zähneputzen herangeführt werden und es erlernt haben, bis sie flüssig schreiben können. Das ist die Faustregel, von der ich jetzt nicht wüsste, dass sie präzise erforscht ist. Aber sie ist sehr naheliegend. Bis dahin sollten Eltern nachputzen. Das, was die Kinder am Anfang in ihrem Mund machen, dient dem Erwerb der Fertigkeit. Der Lernprozess ist ähnlich wie beim Schreibenlernen: Kinder schreiben am Anfang noch nicht ganz in der Zeile und die Wörter sind noch nicht so leserlich. Mit der Zeit wird dies besser und so kann man sich das auch beim Zähneputzen vorstellen.
Allerdings funktioniert der Erwerb dieser Fertigkeit bislang nur ungenügend. Ihre Untersuchungen verdeutlichen [3,4,5], dass einerseits die in der Gruppenprophylaxe erlernte Systematik von Heranwachsenden nicht anhaltend umgesetzt wird. Andererseits geben die Eltern Heranwachsender kein gutes Putzvorbild ab. Eltern wie Kinder vernachlässigen bestimmte Bereiche, insbesondere die Zahninnenflächen. Weshalb reicht die Instruktion von Kindern und Jugendlichen in der Gruppen- und Individualprophylaxe offenbar nicht aus?
Prof. Deinzer: Gruppen- und Individualprophylaxe sind punktuelle Übungseinheiten für etwas, was ich täglich tue. Es besteht also eine relativ geringe Dichte an Impulsen, die das Erlernen der Fähigkeit unterstützen. Das reicht nicht aus. Wenn Sie Ihren Sport täglich falsch ausüben und sich einmal im halben Jahr korrigieren lassen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie danach alles immer richtig machen, ebenfalls relativ gering. Deshalb betont die Gruppen- und Individualprophylaxe, dass Eltern auch einen Teil der Verantwortung tragen. Allerdings müssten Eltern befähigt werden, diese Verantwortung zu übernehmen, indem man ihnen beibringt, wie man richtig putzt.
Wie könnte man dieses Ziel praktisch umsetzen? Sollten die Eltern zur Gruppenprophylaxe mitkommen oder sich im Rahmen der Individualprophylaxe beim Zahnarzt in der Zahnpflege unterweisen lassen?
Prof. Deinzer: In der Tat, eine Zahnärztin, die ich kenne, macht das so: Sie bringt Eltern und Kindern sauberes Zähneputzen bei und hat damit offenkundig gute Erfolge. Wobei ein halbes Jahr Wartezeit bis zur ersten Rückmeldung in der nächsten Prophylaxesitzung aus psychologischer Sicht zu lang ist. Ich stelle mir kurzfristigere Rückmeldungen vor. Eine Möglichkeit wäre, die Eltern anzuleiten, die Zähne nach dem Putzen anzufärben und zu schauen, in welchen Bereichen der Gingivaränder noch Plaque übriggeblieben ist. Das verlangt allerdings einen hohen individuellen Einsatz. Aber in diese Richtung müssten unsere Bestrebungen gehen: Man muss die Eltern mit den Kindern anleiten, damit die Eltern zuhause die notwendigen Impulse geben können. Alternativ könnten wir diese Verantwortung noch stärker in die Schulen verlagern, weil wir erkennen, dass die Vorbildrolle zumindest von dieser Generation Eltern nicht geleistet werden kann. Das tägliche Zähneputzen würde dann zum Schulunterricht gehören. In anderen Ländern ist das so.
Ihre Gießener Arbeitsgruppe publizierte 2022 verschiedene Teilstudien unter dem Titel “Patients’ awareness regarding the quality of their oral hygiene: development and validation of a new measurement instrument” [6]. Darin beschreiben Sie die Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur Eigeneinschätzung von Mundhygienefähigkeiten. Dieser Fragebogen zur „Self-perceived oral cleanliness“, kurz SPOC, basiert auf einem einfachen Plaqueindex. Wie genau können Eltern und Kinder ihre Putzfähigkeiten einschätzen?
Prof. Deinzer: Die Eltern und die Kinder gehen davon aus, dass sie ungefähr 70% der Zahnfleischrandsegmente sauber putzen. Tatsächlich haben wir gesehen, dass nur 30% sauber werden und ungefähr 70% plaquebedeckt bleiben. Je nach Stichprobe variierten die Ergebnisse leicht.
Weshalb erscheint Ihnen die Selbsteinschätzung der Patientinnen und Patienten so wichtig?
Prof. Deinzer: Bei guter Mundhygiene geht es nicht nur um ein Verhalten, sondern um mehrere einzelne Verhaltensweisen, die zusammengehören. So ist es wichtig, regelmäßig die Zähne zu putzen. Das machen 90% der Bevölkerung sowieso; da muss ich nicht zusätzlich motivieren. Dann geht es darum, zu trainieren, die Zähne wirklich sauber zu putzen. Das ist das zweite Verhalten. Und schließlich muss ich bereit sein, dieses Können täglich anzuwenden. Das sind 3 unterschiedliche Verhaltensweisen, die auch psychologisch unterschiedlich adressiert werden müssen. Gesundheitspsychologische Modelle zeigen, dass ein Verhalten umso wahrscheinlicher wird, je klarer das Problembewusstsein ist, je stärker die Selbstwirksamkeitserwartung ist (also das Zutrauen in mich, dass ich das erwünschte Verhalten auch zeigen kann), je positiver die Abwägung der Vor- und Nachteile ausfällt und je normaler das Verhalten wahrgenommen wird. Und durch eine konkrete Planung, wer wann, wo und mit welchen Mitteln das Ganze durchführt, wird es wahrscheinlicher, dass das angestrebte Verhalten umgesetzt wird. Wenn jedoch die Basis, nämlich das Problembewusstsein fehlt, und man der Ansicht ist, dass man das schon gut macht und dass zweimal täglich mindestens 2 Minuten Putzen ausreichend für eine gute Mundhygiene ist, dann kann keine Motivation entwickelt werden, etwas zu verändern.
Es ist sicherlich nicht einfach, Patientinnen und Patienten klarzumachen, dass sie ihre Fähigkeiten, Zähne sauber zu putzen ganz falsch einschätzen. Wo kann man ansetzen?
Prof. Deinzer: Man kann Patienten verdeutlichen, dass es in der zahnmedizinischen Forschung und Praxis ein großes Defizit gibt, für das sie nicht verantwortlich sind. Es gibt wenig Forschung dazu, wie man gutes Zähneputzen vermitteln kann, und unsere Studien zeigen, dass es im Zuge der Gruppen- und Individualprophylaxe nicht gelingt [5]. Statt Patienten Schuld zuzuweisen, können Zahnmediziner den Fehler eingestehen, dass beim Vermitteln des Zähneputzens vielleicht zu sehr auf Karies fokussiert wurde und so die Patienten gar nicht gelernt haben, dass es noch Parodontalerkrankungen gibt.
Ich stelle mir das psychologisch nicht einfach vor, Patientinnen und Patienten in ihrer Situation abzuholen und kein Schuldbewusstsein auszulösen.
Prof. Deinzer: Ja, aber das ist eben die Kunst, dass die Zahnärztin oder der Zahnarzt das auf sich bezieht und sagt: Unser Fehler in der Zahnmedizin – und jetzt schauen wir gemeinsam, wie wir das Problem lösen!
Was können Zahnärzte und Zahnärztinnen noch tun, um das Erlernen des Zähneputzens besser zu unterstützen?
Prof. Deinzer: Ich würde mir wünschen, dass in der Aufklärung sehr stark betont wird, worum es eigentlich geht, nämlich den Zahn plaquefrei zu bekommen. Das heißt, es geht nicht darum, 2 Minuten zu putzen, es geht nicht darum, eine bestimmte Systematik einzuhalten. Das kann im Prinzip jeder machen, wie er will. Am Ende sollen die Zähne von allen 5 Seiten, die man mit unterschiedlichen Hygieneinstrumenten erreichen kann, gereinigt sein und zwar komplett plaquefrei – das ist die Idee des Zähneputzens. Man kann z.B. die Patientinnen nach einer Erklärung, wie man Zähne systematisch putzen kann, in der Zahnarztpraxis bitten, so gut zu putzen, wie sie können, und dann durch Anfärben prüfen, wo es nicht funktioniert hat. Die Stellen können die Patienten unter Anleitung dann nochmal angehen und sehen, wie sie die Beläge wegbekommen. So können sie es einfach selbst ausprobieren. Wichtig ist das Feedback, ob es wirklich sauber geworden ist und wo noch Probleme sind.
Gibt es auch Dinge, die man in der Mundhygienemotivation unbedingt vermeiden sollte? Sie haben schon gesagt, Schuldzuweisungen sind eine schlechte Idee.
Prof. Deinzer: Ja, dass z.B. Patientinnen und Patienten mit schlechter Mundhygiene oder offensichtlichen Schwierigkeiten beim Zähneputzen einfach eine elektrische Zahnbürste empfohlen wird, ohne hierzu mehr zu erklären, ist wenig zielführend. Das macht es dem zahnärztlichen Team zwar einfach, löst aber das Problem nicht. Wenn die elektrische Zahnbürste die Gingivaränder gar nicht erst erreicht, werden sie eben auch nicht sauber. Ich kann die Verantwortung für die Sauberkeit der Zähne nicht der elektrischen Bürste überlassen [8]. Mir scheint aber, das wird manchmal genauso gemacht und gesehen. Es ist ein Irrtum, dass die elektrische Zahnbürste von alleine putzt, ganz als würde sie sich selbstständig durch den Mund bewegen. Das tut sie nicht. Und die Apps, die versprechen, genau zu sagen, wo man schon war und wo nicht und wo es jetzt „sauber“ ist, halten dieses Versprechen nicht. Zumindest war das bei den Produkten, die wir in unserem Institut getestet haben, nicht der Fall.
 Konstantin Yuganov/AdobeStock
Konstantin Yuganov/AdobeStockEs führt also kein Weg daran vorbei, das Putzen gut zu lernen …
Prof. Deinzer: Ja, und man muss auch davon ausgehen, dass eine einmalige Schulung nicht unbedingt ausreicht. Vielleicht muss der Patient, die Patientin erst einmal häufiger kommen, um das Putzen wiederholt zu üben und darin sicherer zu werden. Wenn man dann richtig gut putzen kann, kann man es sogar schaffen, die Zähne so sauber zu halten, dass eine PZR gar nicht nötig ist. Das muss man sich bewusst machen. Wenn man das Zähneputzen gut beherrscht, muss man auch nicht unbedingt zweimal am Tag ganz sauber putzen. Zweimaliges Putzen ist zwar gut für die Fluoridversorgung. Für die Vermeidung von Zahnfleischentzündungen und der daraus entstehenden Parodontitis reicht es aber in der Regel aus, den Aufwand, die Zähne komplett sauber zu putzen, nur einmal am Tag zu betreiben. Es gibt meines Wissens auch keine Evidenz, dass dann das komplette Säubern abends erfolgen muss. Wenn man abends zu müde ist, warum nicht morgens oder mittags?
Abschließend ein Ausblick: Welche Forschungsfragen werden Sie in nächster Zeit mit Ihrer Arbeitsgruppe in Angriff nehmen?
Prof. Deinzer: Wir entwickeln zurzeit eine Bürste, die es uns ermöglicht, das Zahnputzverhalten automatisch zu analysieren, ohne auf Videoaufnahmen zurückgreifen zu müssen. Denn das Zahnputzverhalten per Video zu analysieren, ist sehr mühsam. In den nächsten Studien werden wir außerdem untersuchen, wie wir Erwachsenen, speziell auch Parodontitispatienten, das Zähneputzen besser beibringen können.
Im Zuge der Sechsten Mundgesundheitsstudie vergleichen wir Menschen, die sehr gut geputzt haben, mit Menschen, die sehr schlecht geputzt haben, hinsichtlich ihres Verhaltens. Um zu verstehen, worin die entscheidenden Unterschiede bestehen, haben wir die Probanden auf Video aufgezeichnet. Und jetzt werten wir aus, ob die Unterschiede nur durch die Vernachlässigung bestimmter Flächen entstehen oder ob z.B. unterschiedliche Bewegungen festzustellen sind. Hintergrund ist, dass wissenschaftlich noch nicht gesichert ist, welche Zahnputztechnik eigentlich die beste wäre. Besser zu verstehen, mit welchen Techniken man am besten putzen könnte und mit welchen Instruktionen wir Patientinnen und Patienten am besten unterstützen, das ist unser großes Ziel.
Vielen Dank für das Interview!
Das Interview führte Dagmar Kromer-Busch.
 Entdecke CME Artikel
Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download
Entdecke Artikel mit Download 






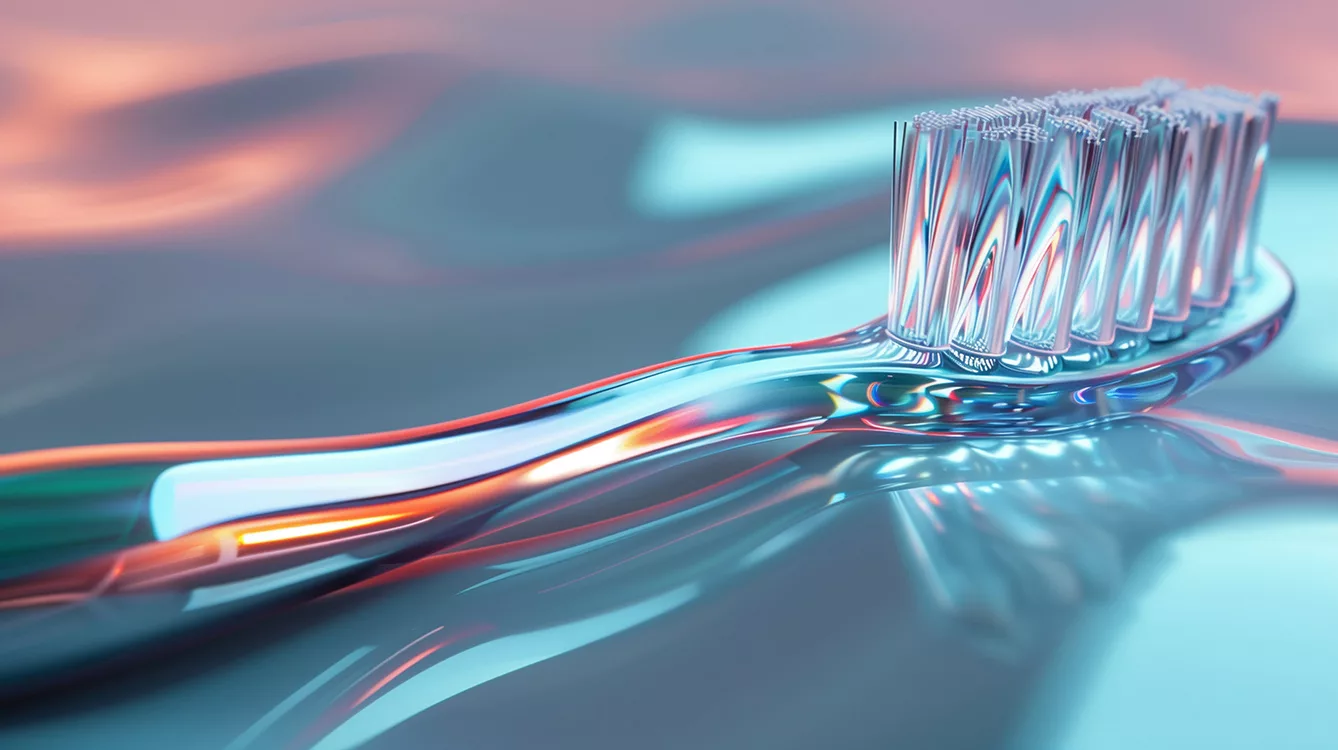
 Mit Google einloggen
Mit Google einloggen
 Mit Facebook einloggen
Mit Facebook einloggen
Keine Kommentare.