|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Prof. Terheyden, welche Herausforderungen und Chancen bringt KI für die Dentalbranche Ihrer Meinung nach?
 Prof. Dr. Dr. Terheyden
Prof. Dr. Dr. TerheydenEs hat schon oft die Einführung einer neuen Technologie in der Zahnheilkunde gegeben, aber die Digitalisierung ist ein Megatrend, der in der Gegenwart fast alle Bereiche des Arbeitslebens verändert. Technisch bedeutet KI, dass eine Software eine bestimmte Entscheidung iterativ durch verknüpfte Rechenknoten treiben kann, die sich jeweils die Wahrscheinlichkeit eines früheren Entscheidungsausgangs merken können. Dadurch lernt das System mit der Zeit. Die KI bleibt aber ein „stochastischer Papagei“, denn KI ist nach meiner Kenntnis nicht wirklich kreativ, sondern kann nur bestehende Vorlagen anhand von Auftretenswahrscheinlichkeiten verknüpfen. Computer bleiben in Zukunft hoffentlich Rechenknechte, die unsere Arbeit erleichtern. Der Zahnarzt und die Zahnärztin als Person werden so bald nicht ersetzbar sein, denn es ist manuelle Arbeit höchster Präzision in Einzelfertigung gefragt, so dass bisherige Systeme zu ungenau sind und sich aufgrund der Einzelfertigung auch finanziell nicht so leicht rechnen wie in anderen Branchen.
Wie müssen Unternehmen und Mitarbeitende umdenken?
Meines Erachtens sollten KI-Anteile in Softwareprodukten und Geräten deklariert sein. Spätestens wenn das Ergebnis einer Rechenoperation nicht jedes Mal gleich ausfällt – wie z.B. bei der Erkennung des Unterkiefernerven im DVT – sollte man hellhörig werden, denn dann „denkt“ wahrscheinlich eine KI mit. Wir werden vermutlich viele Arbeitserleichterungen erfahren, die rechtliche Verantwortung bleibt aber beim Arzt, auf den in Zukunft erhöhte Kontrollaufgaben zukommen. KI eröffnet auch dem Betrug und der Internetkriminalität neue Möglichkeiten, so dass die Unternehmen Firewalls und Schutzeinrichtungen aufrüsten sollten.
Probleme machen zudem KI-generierte Pressemitteilungen und Fake-Wissenschaftsartikel zu medizinischen Themen – hier ist häufig ein gutes Bauchgefühl der Mitarbeitenden gefragt. Ärztinnen und Ärzte sollten nicht allem Glauben schenken, was auf dem Bildschirm erscheint, was am besten auf der Grundlage einer sicheren universitären Ausbildung gelingt. Es werden in Zukunft wahrscheinlich auch mehr Patienten in den Praxen mit KI-gefertigten Diagnosen und Therapieplänen erscheinen, wo es dann mehr Geduld braucht, diese mit der Realität zu verbinden.
Welche Marktveränderungen zeichnen sich ab, und wie können wir digitale Prozesse optimal nutzen?
Bei allen Innovationen ist für die Praxen der Zeitpunkt fraglich, wann man mit der Investition einsteigt – als Vorreiter oder wenn die Technik sich bereits breit etabliert hat? Hierfür sollte weniger Marketing und kompetitives Denken ausschlaggebend sein, sondern ob es Vorteile für Patienten, eine Arbeitserleichterung fürs Team und eine allgemeine Kostenoptimierung bringt. Das alles zusammen ist bisher nur bei recht wenigen Digitalinnovationen in der Zahnheilkunde gegeben, beispielsweise beim 3D-Röntgen.
Ich persönlich warte auf eine KI-gestützte Dokumentationshilfe, die mein Gespräch am Stuhl inklusive Aufklärung, Antragswesen, Kostenvereinbarungen usw. in karteikartenfähigen Text umwandelt, direkt daraus einen Arztbrief erstellt (auch für die EPA) und eine rechtssichere Abrechnung ohne vergessene Ziffern automatisiert. Ich möchte mehr Stuhlzeit und weg von patientenfernen Tätigkeiten als Arzt und Zahnarzt. Dafür ist die KI meines Erachtens prädestiniert.
„Den Befund und Arztbrief schreibt die KI…!“ In welchen Anwendungen sehen Sie nicht nur „Tools“, sondern echte „Game Changer“?
Die bisherige Dokumentation umfasst häufig vorwiegend Gebührenziffern, so dass im Streitfall der völlig falsche Eindruck entsteht, der Arzt sei nur an der Abrechnung interessiert. Die vielen Stunden persönlicher Zuwendung und Beratung der Patientinnen und Patienten sind in der Regel unzureichend dokumentiert und haben daher in der Logik des modernen Rechtsstaates nicht stattgefunden. Ich hoffe, dass sich in diesem Punkt die KI-gestützte Dokumentation positiv für eine ehrliche Darstellung der ärztlichen Zuwendung auswirkt, sei es auch so, dass man erinnert wird, wenn man einmal einen Punkt vergessen hat anzusprechen.
Optische Implantatsysteme markieren einen Wandel in der Haptik des Arbeitens. Werden sich Systeme, welche „Sicherheit und Planbarkeit“ garantieren gegenüber der „Anwendung aus der Hand“ behaupten?
Implantatnavigationssysteme – ob dynamischer oder statischer Art – sind eine gute Hilfe für Anfänger und Berufseinsteiger, um zu einer planbaren Implantatpositionierung zu kommen. Der Routinier kann aber mehr, denn er fühlt beim Bohren des Implantats den Knochen, was zu einer optimierten Primärstabilität und weniger Bohrtrauma führt – und zwar ohne Zusatzkosten. Dies ist insbesondere bei Knochenmangel wichtig. Beispielsweise kann eine Implantatinsertion in ein Bone Splitting kaum navigiert durchgeführt werden, weil sich der Knochen gegenüber dem präoperativen Bild verändert hat. Die optisch geführten Systeme haben Ungenauigkeiten von zum Teil mehreren Grad Achsneigung und mehren Millimetern in der Länge. Die fertigende Industrie geht z.B. für hochpräzise Tätigkeit einen anderen Weg über mechanisch geführte Roboterarme, die die feinsten Bewegungen erlernen können und wahrscheinlich auch die Zukunft in der robotischen Zahnheilkunde sein werden.
1990 ging man schon fast davon aus, dass der Mensch im Jahr 2010 seinen Sonntagsspaziergang auf dem Mars tätigen würde. Wenn Sie den Blick auf die „Ist-Situation“ der digitalen Entwicklung wenden, haben sich die Prognosen bewahrheitet, oder kam doch alles anders?
Ich sehe die Digitalisierung schon als eine der drei großen technologischen Revolutionen der Menschheit nach Ackerbau im Neolithikum (Nutzung der Photosynthese), fossile Energieträger/Dampf- und Motorkraft (Unabhängigkeit von Muskelkraft) und jetzt die Digitalisierung als Unabhängigkeit von der eigenen Rechenkapazität des Menschen. Einiges ist so gekommen, wie die Science-Fiction es in den Fünfzigern vorhergesagt hat, beispielsweise die Bildtelefonie. Digitale Methoden werden in der Zahnheilkunde von bestimmten Interessengruppen immer sehr stark forciert, aber wenn man die tägliche zahnärztliche Therapie ansieht, funktioniert das meiste noch analog und zwar auch bei Stromausfall. Die Fortschritte bedingen oft auch einen höheren Ressourcenverbrauch, und diese stellen sich zunehmend als endlich dar. Ich würde das Analoge also nicht völlig aufgeben. Wie gelingt der digitale Wandel auch bei niedergelassenen MKG-Chirurgen?
Das ist meine Berufsgruppe und hier finde ich sehr gut, dass ich weder nach einer verschollenen Patientenakte noch nach Röntgenbildern suchen muss, was früher viel Zeit in Anspruch nahm. Wie gesagt ist das 3D-Röntgen ein großer Fortschritt, auf das alle drei Kriterien zutreffen. Niedergelassene MKG-Chirurgen operieren viel, so dass sich Investitionen in Robotik oder Navigation eher rechnen, als wenn nur selten operiert wird. Die Kommunikation mit den Überweisern funktioniert durch Systeme wie KIM besser als zuvor. Es gibt in der MKG-Praxis viele Anwendungsfelder, in denen die Digitalisierung Realität ist.
Welche Visionen möchten Sie sonst noch mit uns teilen?
Eine echte „Personalisierte Zahnmedizin“, bei der die Therapieauswahl auf den Omics-Daten, also auf Genom, Proteom, Mikrobiom und Metabolom, beruht, wäre ein großer Fortschritt. Diese ist zum Teil bereits in der Präzisionsonkologie Realität, bedarf aber enormer Rechenkapazitäten zur Speicherung und Integrierung der Datenmengen. Ich stelle mir die Verbesserung der Parodontitistherapie aufgrund der Sulkusfluidanalyse vor. Ich stelle mir vor, dass wir aufgrund der Omics-Daten vorhersagen können, ob eine intraorale Knochentransplantation gelingt, und natürlich die Vorhersage, welche Tumorerkrankung wir in der MKG-Chirurgie dauerhaft heilen können.
 Entdecke CME Artikel
Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download
Entdecke Artikel mit Download 






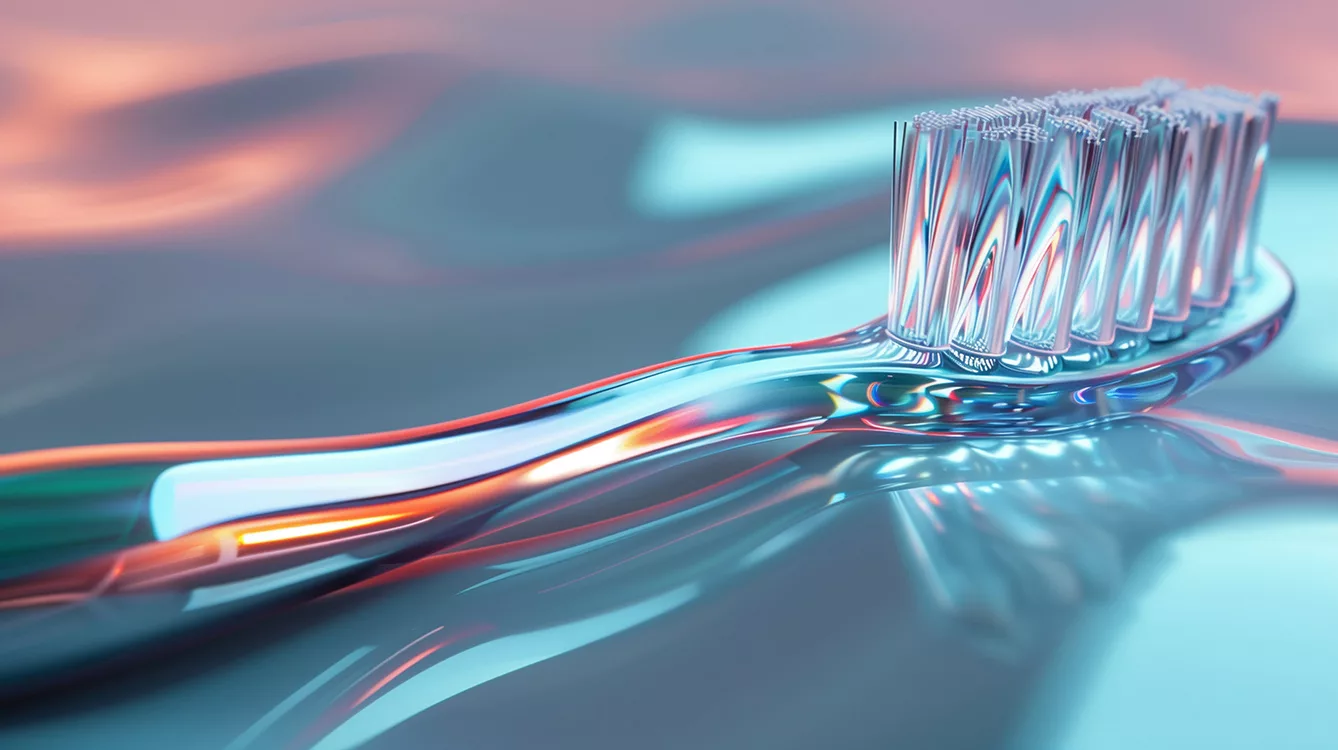
 Mit Google einloggen
Mit Google einloggen
 Mit Facebook einloggen
Mit Facebook einloggen
Keine Kommentare.