|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
ZMK: Frau Milde, wir haben uns bereits im Sommer 2024 über das Thema Praxisbegehungen unterhalten. Gab es seither wesentliche Veränderungen in Bezug auf Praxishygiene – etwa neue Vorschriften oder veränderte Vorgehensweisen bei den Prüfungen?
Viola Milde: Viele der damals angesprochenen Punkte sind weiterhin relevant, haben sich aber in ihrer Bedeutung und Anwendung weiterentwickelt. Bereits im letzten Gespräch haben wir festgestellt, dass sich die Praxisbegehungen seit der Corona-Pandemie deutlich verändert haben – und dieser Trend hat sich nochmals verstärkt.

Zum einen beobachten wir eine deutlich höhere Frequenz: Es finden mehr Begehungen statt als früher. Zum anderen hat auch die Intensität der Prüfungen zugenommen. Die Kontrolle ist gründlicher geworden, und bestimmte Aspekte, die früher noch toleriert wurden, werden heute kritischer bewertet. Bundeslandspezifisch ist das aber noch immer sehr unterschiedlich.
Zudem höre ich immer häufiger, dass nicht mehr nur eine einzelne Person zur Begehung erscheint, sondern zwei oder sogar drei. Diese teilen sich dann auf: Eine Person kontrolliert die digitalen Dokumentationen am PC, eine andere schaut in Schränke und Schubladen, und die dritte befragt die Verantwortlichen.
Ein Dauerbrenner bei der Begehung ist nach wie vor das Thema „Instrumentenaufbereitung“. Zunächst einmal: Dürfen Zahnarztpraxen Instrumente weiterhin manuell aufbereiten?
Die maßgebliche RKI-Richtlinie von 2012 erlaubt grundsätzlich weiterhin manuelle Aufbereitungsverfahren. Man muss allerdings berücksichtigen, dass diese Richtlinie zu einem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, als viele Zahnarztpraxen noch gar keine maschinellen Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (RDG) hatten. Heute hingegen verfügen fast alle Praxen über ein RDG. Und hier greift eine zentrale Formulierung der RKI-Richtlinie: „Bei Reinigungs- und Desinfektionsverfahren sind insbesondere maschinelle Verfahren validierbar und vorrangig anzuwenden.“
In der Praxis bedeutet das: Obwohl die Richtlinie theoretisch noch manuelle Verfahren zulässt, werden diese von vielen Aufsichtsbehörden nicht mehr geduldet. Das hat auch arbeitsschutzrechtliche Gründe – etwa im Hinblick auf die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250*). Dort steht, salopp gesagt: Was in den Thermo darf, muss da rein.
Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Das heißt konkret, dass die meisten Behörden manuelle Prozesse ausschließlich für die Medizinprodukte dulden, die herstellerseitig nicht für einen maschinellen Prozess zugelassen sind.
Die Medizinprodukte-Betreiberverordnung verlangt zudem, dass die Aufbereitung gemäß den Herstellerangaben und mit validierten Verfahren erfolgt. Inwiefern sind Herstellerangaben wirklich bindend? Und überprüfen Behörden diese tatsächlich bei Begehungen?
Es ist üblich, dass Behördenvertreter bereits zu Beginn der Begehung wissen wollen, wo die entsprechenden Herstellerangaben, also Gebrauchsanweisungen oder Bedienungsanleitungen, abgelegt sind. Dabei geht es um drei Kategorien: Erstens die Instrumente, zweitens die aktiven Medizinprodukte (also Geräte), und drittens sämtliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Ich empfehle allen Praxen: Legen Sie auf dem Praxisrechner einen zentralen Ordner mit dem Titel „Gebrauchsanweisungen“ oder „Bedienungsanleitungen“ an – mit Unterordnern für die genannten drei Bereiche.
Warum sind die Herstellerangaben so wichtig?
Ich werde häufig von Praxen gefragt, welche Routineprüfungen an einem Gerät notwendig sind oder ob eine Natriumchloridlösung ein Mehrweggebinde oder ein Einweggebinde ist. Dann verweise ich auf die Herstellerangaben. Gerade bei Instrumenten, die komplex in der Aufbereitung sind, wie Implantatsysteme oder Wurzelkanalinstrumente ist es entscheidend, die Herstellerangaben genau zu kennen. Da kann ich viel falsch machen – und das wollen die Behörden prüfen. Sie schauen sich die Gebrauchsanweisung des Herstellers und parallel die praxisspezifische Arbeitsanweisung an, um zu sehen, ob sie sich entsprechen. Stimmen beide nicht überein, kann das zu erheblichen Problemen führen.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so große Unterschiede in der Aufbereitungsweise von Hersteller zu Hersteller gibt …
In der Tat. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel: Ein Hersteller gibt für eine 25er Nickel-Titan-Handfeile eine maximale Wiederaufbereitung von acht Zyklen an, ein anderer nur vier – und wieder ein anderer überlässt die Entscheidung der Praxis. Das bedeutet: Wenn ich den Hersteller wechsle, darf ich die bisherigen Aufbereitungsprozesse nicht einfach beibehalten. Andernfalls kann es bei einer Begehung zu erheblichen Beanstandungen kommen.
Mit der Einhaltung der Herstellerangaben ist es aber nicht getan – auch die Prozesse der Aufbereitung selbst müssen validiert sein. Welche Verfahren müssen validiert werden?
Die Validierung betrifft alle Schritte der Instrumentenaufbereitung: Reinigung, Desinfektion, Verpackung und Sterilisation. Die dafür notwendigen Geräte müssen geprüft werden: das RDG für Reinigung und Desinfektion, das Siegelnahtgerät für die Verpackung und der Autoklav für die Sterilisation.
Was ist mit dem Validierungsprotokoll – muss ich das wirklich lesen oder reicht es, es einfach abzulegen?
Das Validierungsprotokoll ist kein reines Ablagedokument. Es enthält häufig technische Hinweise und Empfehlungen, die für den Praxisalltag entscheidend sind.
Wichtig: Die Protokolle sind meist nur mit Unterschrift des Praxisinhabers gültig. Zwischen Seite 1 und 6 ist irgendwo ein Bereich für die Unterschrift des Praxisbetreibers. Damit bestätigt er, dass er das Protokoll mit Bemerkungen, Hinweisen und Umsetzungsempfehlungen des Technikers gelesen hat. Fehlt sie, geht die Behörde davon aus, dass die Inhalte nicht zur Kenntnis genommen wurden.
Ich habe einen Fall begleitet, in dem eine Praxis ein erhebliches Ordnungsgeld zahlen musste, weil sie – ohne es zu wissen – ein nicht validiertes Schnellprogramm im Autoklaven genutzt hatte. Man hatte fälschlicherweise angenommen, dass mit der Validierung automatisch alle Programme abgedeckt seien, was nicht der Fall ist. Es ist auch gar nicht sinnvoll, alle Programme validieren zu lassen, da dies sehr teuer wäre. Mein Rat: Überlegen Sie im Vorfeld, welche Programme Sie tatsächlich für Ihre Arbeitsabläufe brauchen.
Für kritische Medizinprodukte ist eine sterile Verpackung vorgeschrieben. Machen Praxen dabei alles richtig?
Die Verpackung von Sterilgut ist in Deutschland ein komplexes Thema, das sehr genauen Vorgaben unterliegt – unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung (DGSV). Diese betreffen z. B. Packungsgröße, die Einpackrichtung und die Kennzeichnung der Instrumente. Die Prüferinnen und Prüfer schauen bei diesem Punkt inzwischen sehr genau hin. Ich habe es erlebt, dass sie quasi „in die Sterilgutschublade hineinkriechen“ und jede einzelne Verpackung begutachten. Wenn durchstichgefährdende Instrumente ohne Schutzkappen verpackt wurden und die Folienseite beschädigt ist, wird dies beanstandet. Die Konsequenzen können drastisch sein – etwa die Verpflichtung zu einem 40-stündigen Sachkundekurs.
Wie können sich Praxen davor schützen, dass sich fehlerhafte Routinen einschleichen?
Wichtig ist die Rolle der hygienebeauftragten Person, also die interne Evaluation und Überwachung der Hygieneabläufe. Die oder der Verantwortliche sollte regelmäßig und möglichst auf Augenhöhe mit dem Team kommunizieren. Am besten bringt sie ein Beispiel mit und spricht kleine Auffälligkeiten direkt an – etwa: „Mir ist beim Steri etwas aufgefallen – ich zeige euch kurz, wie wir es richtig machen.“ Wichtig ist dabei, nicht belehrend oder als Kontrollinstanz aufzutreten. Umgekehrt sollte das Team Rückmeldungen auch offen annehmen können. Ich empfehle außerdem, sich alle zwei Jahre externe Expertise in die Praxis zu holen.
Was ist bei der Lagerung von Arzneimitteln besonders zu beachten?
Zunächst müssen Arzneimittel auf Haltbarkeit überwacht werden – auch nach dem Anbruch. Abgelaufene Produkte sind für die Behörden ein absolutes No-Go. Außerdem sind die Lagerbedingungen entscheidend: Viele Arzneimittel müssen bei 2 bis 8 °C im Kühlschrank aufbewahrt werden.
Ein wiederkehrendes Thema ist auch das Aufziehen von Spritzen für den Tagesbedarf – zum Beispiel mit CHX-Gel. Hier gilt laut Arzneimittelrecht: Eine Befüllung ist nur für den unmittelbaren Gebrauch erlaubt – also maximal für 1 bis 1,5 Stunden, es sei denn die Herstellerangaben regeln dies großzügiger.
Idealerweise sind die Spritzen mit einem Verschlussstopfen verschlossen und werden gekühlt, was in der Praxis kaum machbar ist. Gerade haben wir ein Begehungsprotokoll vorliegen, in dem dieser Punkt bemängelt wird und abgestellt werden soll. Bei solchen Auflagen kann es zu Nachbegehungen kommen.
Im Rahmen solcher Nachbegehungen wird überprüft, ob die Auflage umgesetzt wurde. Kommen die Kontrolleure dann unangekündigt?
Ja, das ist möglich. Nachbegehungen sind häufig, wenn bei der Erstbegehung relativ viele Mängel festgestellt wurden. Die Behörden dürfen jederzeit unangekündigt im laufenden Betrieb kontrollieren. Wurden die Auflagen nicht umgesetzt, liegt eine Ordnungswidrigkeit vor – mit entsprechendem Ordnungsgeld.
Was ist von Last-Minute-Aktionen zu halten, wenn eine Begehung angekündigt wurde? Hilft es, noch eben schnell eine Validierung durchführen zu lassen?
Wenn beispielsweise eine Erst- oder Revalidierung überfällig ist, hilft es nichts, sie erst nach Eingang des Ankündigungsschreibens einzuleiten. In solchen Fällen drohen rückwirkende Ordnungsgelder – teilweise für mehrere Jahre. Anders sieht es bei kleineren organisatorischen Dingen aus: Es ist völlig legitim, vor einer Begehung noch einmal alle Schubladen zu kontrollieren und die Dokumentation zu überprüfen. Dabei dürfen die Praxen „in der Kür“ ruhig ein wenig Mut zur Lücke haben, solange die wirklich sicherheitsrelevanten Abläufe gelebt und verstanden werden. Absolute Perfektion kann – und muss – keine Praxis an den Tag legen und bitte fragen Sie die Behördenvertreter bei Unsicherheit ruhig nach Rat, wie etwas optimal umgesetzt werden sollte. Hinterfragen Sie konstruktiv, wenn Ihnen eine Auflage, die Sie erfüllen sollen, unklar oder aber in anderer Form bekannt ist.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Dagmar Kromer-Busch, Fachjournalistin Dental.
 Entdecke CME Artikel
Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download
Entdecke Artikel mit Download 




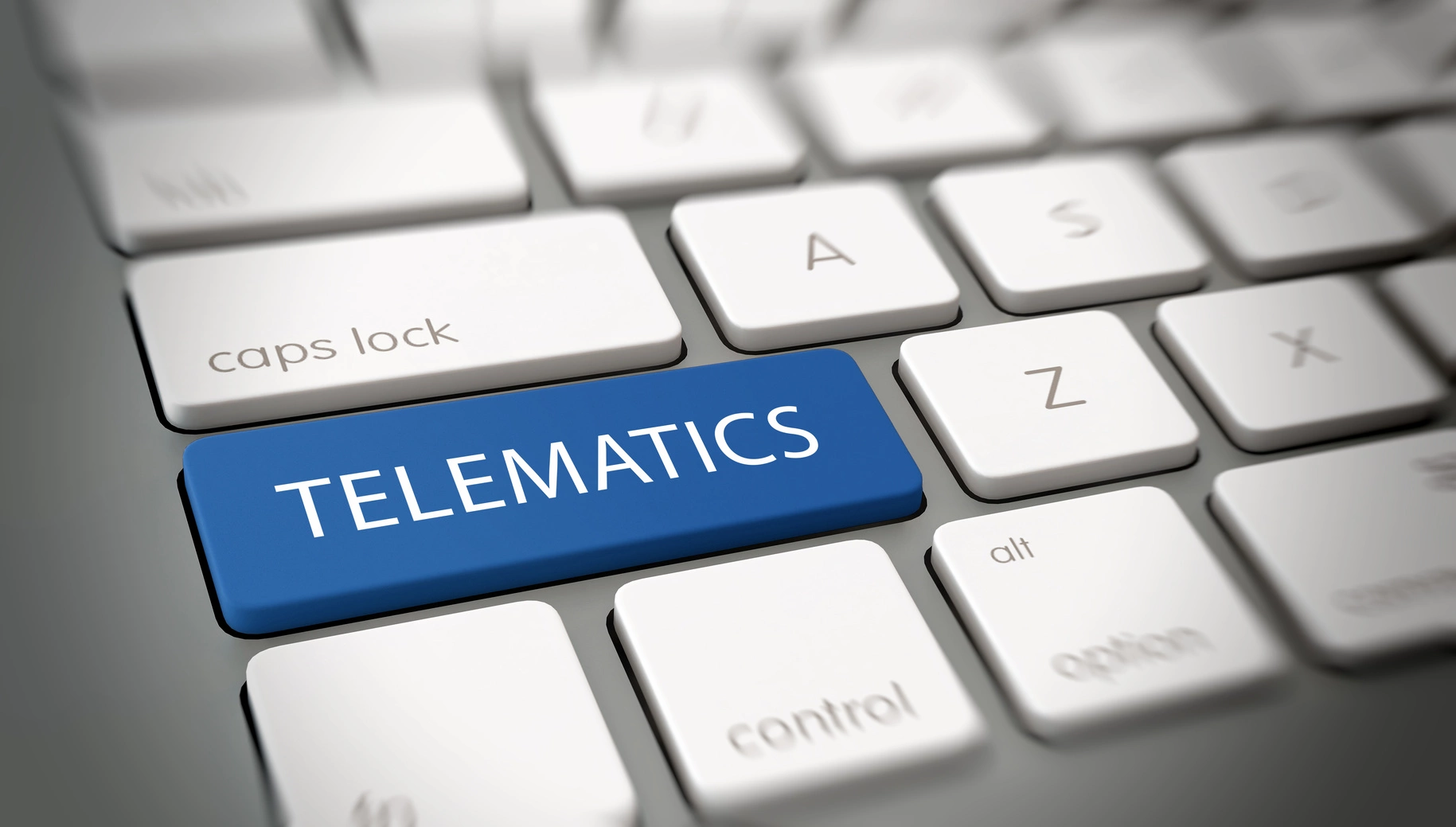


 Mit Google einloggen
Mit Google einloggen
 Mit Facebook einloggen
Mit Facebook einloggen
Keine Kommentare.