|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Grundsätzlich versteht man unter Factoring den laufenden Verkauf von Geldforderungen aus erbrachten Leistungen an einen spezialisierten Finanzdienstleister, den sogenannten Factor. Anstelle auf die Zahlungseingänge der Patienten/-innen warten zu müssen, erhält die Zahnarztpraxis vom Factor umgehend einen Großteil des Rechnungsbetrages ausgezahlt. Der Factor übernimmt im Gegenzug das Ausfallrisiko und in vielen Fällen auch das Debitorenmanagement inklusive Mahnwesen (Abb. 1).
 Sander
SanderVorteile des Factorings für die Zahnarztpraxis
Die Implementierung von Factoring kann für Zahnarztpraxen eine Vielzahl von Vorteilen mit sich bringen, die über die reine Liquiditätsbeschaffung hinausgehen:
- Sofortige Liquidität und verbesserter Cashflow: Der wohl größte Vorteil des Factorings liegt in der schnellen Umwandlung offener Forderungen in liquide Mittel. Dies ermöglicht es der Praxis, kurzfristige finanzielle Verpflichtungen, wie Gehaltszahlungen, Materialeinkäufe oder Investitionen ohne Engpässe zu bedienen. Ein verbesserter Cashflow schafft finanzielle Flexibilität und Unabhängigkeit von den Zahlungszyklen der Patienten/-innen.
- Reduzierung des Ausfallrisikos: Delkredereübernahme – bedeutet, dass ein/-e Schuldner/-in (Debitor) seine/ihre Zahlungspflicht nicht erfüllt und ein Gläubiger (Kreditor) das Risiko eines Forderungsausfalls übernimmt oder dieses Risiko durch eine Delkredereversicherung absichert. Ein wesentlicher Bestandteil vieler Factoring-Verträge ist die Übernahme des Ausfallrisikos durch den Factor. Sollte ein/-e Patient/-in seine/ihre Rechnung nicht bezahlen können, trägt der Factor in der Regel den finanziellen Schaden (abhängig vom gewählten Vertragsmodell). Dies bietet der Zahnarztpraxis Rechtssicherheit und schützt vor unerwarteten Forderungsausfällen, die die Wirtschaftlichkeit der Praxis erheblich beeinträchtigen können.
- Entlastung im Debitorenmanagement: Factoring beinhaltet häufig die Auslagerung des kompletten Debitorenmanagements an den Factor. Dies umfasst die Rechnungsstellung (optional), die Überwachung der Zahlungseingänge, das Mahnwesen und gegebenenfalls die Einleitung von Inkassomaßnahmen. Diese personelle Entlastung ermöglicht es dem Praxisteam, sich verstärkt auf die Patientenversorgung und andere Kernaufgaben zu konzentrieren.
- Administrative Vereinfachung: Durch die Auslagerung des Debitorenmanagements werden interne administrative Prozesse verschlankt. Der Aufwand für die Erstellung und den Versand von Rechnungen, die Überwachung von Zahlungseingängen und das Mahnwesen entfällt weitgehend. Dies spart Zeit und Ressourcen in der Praxisverwaltung.
- Bessere Planbarkeit und Kalkulationssicherheit: Die regelmäßigen Auszahlungen durch den Factor schaffen eine bessere finanzielle Planbarkeit. Zahnarztpraxen können ihre Einnahmen zuverlässiger prognostizieren und somit fundiertere Entscheidungen hinsichtlich Investitionen und der Weiterentwicklung der Praxis treffen.
Nachteile des Factorings für die Zahnarztpraxis
Trotz der zahlreichen Vorteile birgt Factoring auch potenzielle Nachteile, die Zahnarztpraxen bei ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten:
- Abhängigkeit vom Factor: Durch den Verkauf der Forderungen entsteht eine finanzielle Abhängigkeit vom Factoring-Unternehmen. Die Konditionen des Factoring-Vertrags haben direkten Einfluss auf die Liquidität und die finanzielle Flexibilität der Praxis.
- Möglicher Imageverlust: Insbesondere wenn das Factoring nicht diskret abgewickelt wird oder es zu Problemen im Mahnwesen durch den Factor kommt, könnte dies potenziell zu einem negativen Image aus Sicht der Patienten/-innen führen. Eine sensible Kommunikation und die Wahl eines seriösen Factors sind daher entscheidend.
- Verlust der direkten Kontrolle über das Mahnwesen: Die Auslagerung des Mahnwesens bedeutet auch einen Verlust der direkten Kontrolle über diesen Prozess. Die Zahnarztpraxis hat weniger Einfluss darauf, wie Mahnungen formuliert und an die Patienten/-innen versandt werden. Es sollte beachtet werden, ob individuelle Zahlungsabsprachen an den Factor übermittelt werden können.
- Möglicherweise höhere Gesamtkosten: Obwohl Factoring kurzfristig Liquidität schafft, können die Gesamtkosten (Gebühren und Zinsen) unter Umständen höher sein als bei einer herkömmlichen Finanzierung. Eine detaillierte Kostenanalyse ist daher unerlässlich.
Der Kostenfaktor: Was kostet Factoring?
Die Kosten für Factoring sind nicht pauschal festlegbar und variieren je nach verschiedenen Faktoren:
- Umsatzvolumen der Praxis: Höhere Umsatzvolumina führen oft zu günstigeren Konditionen.
- Anzahl und durchschnittliche Höhe der Rechnungen: Eine große Anzahl kleiner Rechnungen kann die Kosten im Verhältnis erhöhen.
- Bonität der Patienten/-innen: Eine gute Zahlungsmoral der Patienten/-innen kann sich positiv auf die Gebühren auswirken.
- Umfang der in Anspruch genommenen Leistungen: Die Kosten steigen in der Regel, wenn neben der reinen Finanzierung auch das Debitorenmanagement und die Übernahme des Ausfallrisikos inkludiert sind.
- Laufzeit des Vertrages: Längere Vertragslaufzeiten können unter Umständen zu besseren Konditionen führen, binden die Praxis aber auch längerfristig.
- Art des Factoring-Modells.
Die Kosten setzen sich in der Regel aus folgenden Komponenten zusammen:
- Factoring-Gebühr (Disagio, also der Betrag, der vom vereinbarten Verkaufspreis der Forderung abgezogen wird, um die Kosten für die Factoring-Gesellschaft zu decken): Ein prozentualer Abschlag auf den Rechnungsbetrag, der als Gebühr für die Dienstleistung des Factors dient. Dieser Satz liegt üblicherweise zwischen 0,5 und 3% des Forderungsbetrages, kann aber je nach den oben genannten Faktoren variieren.
- Zinsen: Für die vorzeitige Auszahlung der Forderung können Zinsen anfallen, die sich an den aktuellen Marktzinsen orientieren.
- Weitere Gebühren: Je nach Vertrag können zusätzliche Gebühren für spezielle Leistungen, wie die Übernahme des Mahnwesens oder Inkassokosten, anfallen.
Ein konkretes Beispiel: Bei einem monatlichen Umsatz von 50.000 Euro und einer angenommenen Factoring-Gebühr von 1,5% würde die Praxis monatlich 750 Euro an den Factor zahlen. Hinzu kämen gegebenenfalls Zinskosten für die vorzeitige Auszahlung.
Unterschiedliche Vertragsmodelle im Überblick
Factoring-Anbieter offerieren verschiedene Vertragsmodelle, die sich hinsichtlich Kosten, Laufzeit und Leistungsumfang unterscheiden:
- Echtes Factoring (mit Delkredereübernahme): Der Factor übernimmt das volle Ausfallrisiko. Dies bietet die höchste Sicherheit, ist aber in der Regel auch mit höheren Gebühren verbunden.
- Unechtes Factoring (ohne Delkredereübernahme): Das Ausfallrisiko verbleibt bei der Zahnarztpraxis. Diese Variante ist oft kostengünstiger, bietet aber keine Absicherung gegen Zahlungsausfälle.
- Offenes Factoring: Die Patienten/-innen werden darüber informiert, dass die Forderungen an einen Factor verkauft wurden.
- Stilles Factoring: Die Patienten/-innen bleiben im Unklaren über die Abtretung der Forderungen. Diese Variante erfordert ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Praxis und Factor und ist oft mit höheren Anforderungen verbunden.
- Full-Service-Factoring: Umfasst neben der Finanzierung auch das komplette Debitorenmanagement inklusive Mahn- und Inkassowesen.
- Inhouse-Factoring: Die Praxis übernimmt weiterhin Teile des Debitorenmanagements, während der Factor primär die Finanzierung und gegebenenfalls das Ausfallrisiko übernimmt.
Die Laufzeiten von Factoring-Verträgen können variieren. Es gibt kurzfristige Verträge, die beispielsweise für einzelne Projekte oder zur Überbrückung temporärer Liquiditätsengpässe abgeschlossen werden, aber auch langfristige Rahmenverträge, die eine kontinuierliche Finanzierung und administrative Entlastung gewährleisten.
Die Kosten sind eng mit dem gewählten Modell und der Vertragslaufzeit verknüpft. Längere Laufzeiten können unter Umständen zu besseren Konditionen führen, während flexible, kurzfristige Modelle oft teurer sind
Folgen (oder Vorteile) für das gewerbliche Labor
Auch für gewerbliche zahntechnische Labore kann Factoring eine interessante Option sein. Ähnlich wie bei Zahnarztpraxen profitieren Labore von der schnellen Liquiditätsgenerierung aus ihren erbrachten Leistungen an die Praxen. Dies ermöglicht es Laboren, ihre eigenen Verbindlichkeiten zu begleichen, in neue Technologien zu investieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die Vorteile für Labore sind analog zu denen der Zahnarztpraxen:
- verbesserter Cashflow: ermöglicht pünktliche Zahlungen an Lieferanten und Mitarbeiter/-innen
- reduziertes Ausfallrisiko: schützt vor Zahlungsausfällen durch Zahnarztpraxen
- Entlastung im Debitorenmanagement: Konzentration auf die zahntechnische Arbeit
- planbare Einnahmen: ermöglichen eine sichere Kalkulation und Investitionsplanung
Personelle Entlastung in der Zahnarztpraxis
Ein signifikanter Vorteil des Factorings für Zahnarztpraxen ist die personelle Entlastung. Durch die Auslagerung des Debitorenmanagements an den Factor werden wertvolle Arbeitszeit und Ressourcen der Mitarbeiter/-innen freigesetzt. Aufgaben, wie die Erstellung und der Versand von Rechnungen, die Überwachung von Zahlungseingängen, das Mahnwesen und die Korrespondenz mit säumigen Zahlern, entfallen oder werden deutlich reduziert. Diese gewonnene Zeit können die Mitarbeiter/-innen für wichtigere Aufgaben nutzen, beispielsweise:
- Verbesserung der Patientenbetreuung: mehr Zeit für die individuelle Beratung und Behandlung der Patienten/-innen
- Effizienzsteigerung in der Praxisorganisation: Optimierung von Abläufen und Prozessen
- Qualitätssicherung: Fokussierung auf die Einhaltung hoher Qualitätsstandards in der Behandlung
- Fort- und Weiterbildung: Investition in das Know-how des Teams
Die personelle Entlastung trägt somit nicht nur zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit bei, sondern kann auch die Qualität der erbrachten Leistungen und die Wirtschaftlichkeit der Praxis insgesamt positiv beeinflussen.
| Checkup |
| Was sollte bei der Auswahl eines Factoring-Unternehmens beachtet werden? 1. Erfahrung und Spezialisierung – Hat das Factoring-Unternehmen Erfahrung im Gesundheitswesen oder speziell im zahnärztlichen Bereich? – Versteht das Unternehmen die besonderen Anforderungen und Abläufe einer Zahnarztpraxis? 2. Angebotene Dienstleistungen – Bietet das Unternehmen Factoring-Modelle an, die auf die Bedürfnisse von Zahnarztpraxen zugeschnitten sind? – Gibt es flexible Vertragslaufzeiten und individuelle Lösungen? 3. Kosten und Gebühren – Wie hoch sind die Factoring-Gebühren (z.B. Prozentsatz des Umsatzes, Fixkosten)? – Gibt es versteckte Kosten oder zusätzliche Gebühren? 4. Zahlungsbedingungen – Wie schnell erfolgt die Auszahlung der Factoring-Summe? – Gibt es klare und transparente Zahlungs- und Abrechnungsmodalitäten? 5. Kundenservice und Support – Bietet das Unternehmen persönliche Ansprechpartner/-innen? – Wie sind die Erreichbarkeit und Reaktionszeit bei Fragen oder Problemen? 6. Vertragsbedingungen – Sind die Vertragsbedingungen transparent und verständlich? – Gibt es flexible Optionen bei Vertragsänderungen oder -kündigungen? 7. Reputation und Referenzen – Hat das Unternehmen positive Bewertungen oder Referenzen von anderen Zahnarztpraxen? – Gibt es Empfehlungen aus dem Gesundheitswesen? 8. Datenschutz und Sicherheit – Werden sensible Patientendaten sicher und datenschutzkonform verarbeitet? – Welche Sicherheitsmaßnahmen sind im Unternehmen implementiert? 9. Technologische Integration – Lässt sich das Factoring-System nahtlos in die bestehende Praxissoftware integrieren? – Gibt es Schnittstellen oder Automatisierungsmöglichkeiten? 10. Langfristige Partnerschaft – Ist das Unternehmen an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert? – Bietet es Beratung und Unterstützung bei finanziellen Fragen? |
Fazit: Factoring als strategisches Instrument für die Zahnmedizin
Factoring stellt für Zahnarztpraxen und zahntechnische Labore eine durchdachte Alternative zum klassischen Forderungsmanagement dar. Die Vorteile in Bezug auf Liquidität, Risikominimierung und administrativer Entlastung sind signifikant und können einen wesentlichen Beitrag zu einem effizienten und zukunftsorientierten Praxismanagement leisten. Allerdings ist eine sorgfältige Analyse der individuellen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen unerlässlich. Zahnärzte/-innen sollten die verschiedenen Vertragsmodelle, Kostenstrukturen und potenziellen Nachteile genau prüfen, um die für ihre Situation optimale Lösung zu finden.
Die Wahl eines seriösen und erfahrenen Factoring-Partners sowie eine transparente Kommunikation gegenüber den Patienten/-innen (bei offenem Factoring) sind entscheidend für eine erfolgreiche Implementierung. Letztendlich kann Factoring, strategisch eingesetzt, zu einer höheren finanziellen Flexibilität, mehr Sicherheit und einer spürbaren Entlastung im Praxisalltag führen und es den Akteuren im Gesundheitswesen ermöglichen, sich noch stärker auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren: die Gesundheit und Zufriedenheit ihrer Patienten/-innen.
 Entdecke CME Artikel
Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download
Entdecke Artikel mit Download 



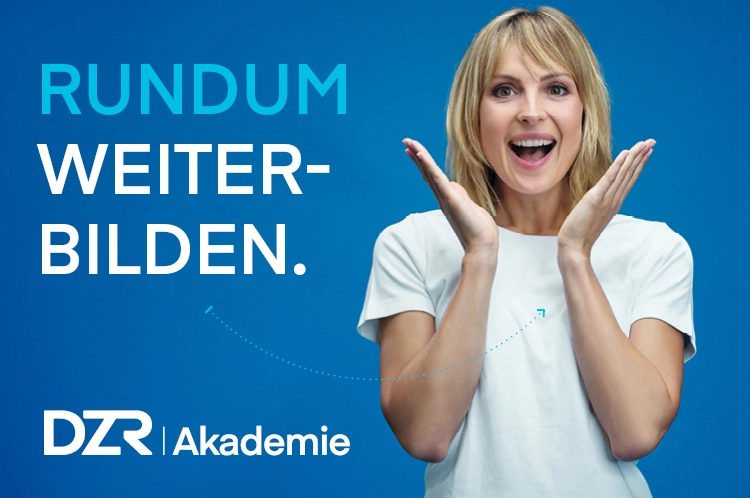
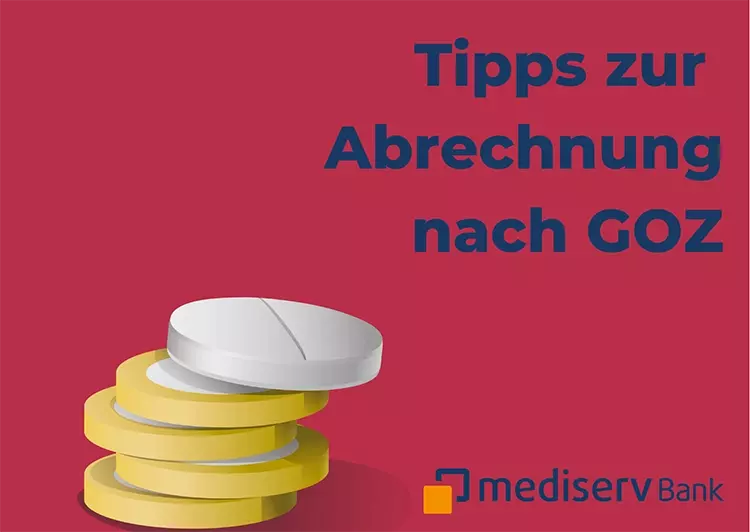


 Mit Google einloggen
Mit Google einloggen
 Mit Facebook einloggen
Mit Facebook einloggen
Keine Kommentare.