|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Ernährung ist ein zentraler Faktor für die allgemeine, aber auch orale Gesundheit. In den letzten Jahrzehnten haben sich viele neue Erkenntnisse über den Einfluss der Ernährung auf die parodontale Gesundheit ergeben. Dabei hat Ernährung sowohl einen lokalen Einfluss auf das orale Mikrobiom als auch systemisch über gesamtkörperliche Wege.
Insbesondere der Zuckerkonsum konnte als eindeutiger Risikofaktor für die gingivale Entzündung identifiziert werden. Da Zuckerkonsum ein geteilter Risikofaktor für andere Erkrankungen wie Karies, Übergewicht, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist, profitieren mehrere Gesundheitsbereiche von einer Vermeidung von Zucker. Ernährungsberatung sollte ein fester Bestandteil in der zahnärztlichen Praxis sein, da sie sowohl die orale als auch die allgemeine Gesundheit fördern kann. Diese Position wird mittlerweile auch von der Bundeszahnärztekammer in einem Positionspapier vertreten [4].
Wie entstehen parodontale Entzündungen?
Während die gingivale Entzündung über viele Jahrzehnte als reines Ergebnis einer Biofilmakkumulation gesehen wurde, ist mittlerweile besser verstanden, wie Mikroorganismen in dem Biofilm mit dem Wirtsorganismus und entsprechenden Risikofaktoren – wie zum Beispiel Genetik, Entzündung, Rauchen, Diabetes – interagieren. Aktuelle ätiologische Modelle verstehen Gingivitis und Parodontitis als eine dysbalancierte Reaktion zwischen dem oralen Mikrobiom und einem gestörten Immunsystem, welches die Entzündungsreaktion maßgeblich reguliert [12]. Entsprechend hängt die Reaktion der Gingiva auf eine Biofilmakkumulation maßgeblich vom Immunsystem ab, das stark von Lebensstilfaktoren (wie Ernährung, Rauchen, körperlicher Aktivität oder Dauerstress), anderen Erkrankungen und der Genetik beeinflusst ist [12,35].
Darauf basierend können Menschen durchaus auch unter biofilmreichen Zuständen ein gesundes Zahnfleisch aufweisen. Dies konnte unter anderem in einem Steinzeit-Projekt des Schweizer Fernsehens („Pfahlbauer von Pfyn“) beobachtet werden, bei welchem 10 Probandinnen und Probanden 4 Wochen lang unter Steinzeitbedingungen und ohne Mundhygienemaßnahmen lebten [3]. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trotz erhöhter Biofilmwerte keine zusätzliche Gingivitis entwickelten und sogar ein geringeres Bluten auf Sondieren aufwiesen. Die Autoren der begleitenden Untersuchung vermuteten, dass dieser Effekt durch den Wegfall von prozessierten Kohlenhydraten zustande kam. Prozessierte Kohlenhydrate sind konzentriert vorhanden z.B. in Zucker, Süßigkeiten, Weißmehlen, Säften und Softdrinks.
Dass Ernährung tatsächlich einen so bedeutenden Einfluss auf die gingivale Entzündungsreaktion ausüben kann, konnte durch drei folgende, randomisierte und kontrollierte klinische Studien an den Universitäten in Freiburg und Heidelberg dargestellt werden [2,36,37]. Diese Studien fokussierten ebenfalls auf eine Vermeidung von prozessierten Kohlenhydraten, beinhalteten allerdings auch noch andere Faktoren, wie einen angepassten Konsum von Omega-3-Fettsäuren und eine mikronährstoffreiche Ernährung.
Eine zusammenfassende Analyse der dargestellten Ernährungsstudien konnte zeigen, dass Ernährung sowohl eine Art von „Plaqueresistenz“ oder sogar „gesundem Biofilm“ hervorrufen könnte. Denn die Studienergebnisse zeigten für eine gesunde, prozessierte Kohlenhydrate vermeidende Ernährung eine verminderte Korrelation zwischen Biofilm und Gingivitis sowie eine verringerte Gingivitis bei mehr Biofilm [35]. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Ernährung bei nicht rauchenden und ansonsten gesunden Patientinnen und Patienten den entscheidenden Einfluss ausübt, ob Biofilm eine Gingivitis verursacht oder nicht.
Wie beeinflusst die Ernährung parodontale Entzündungen?
Man kann derzeit davon ausgehen, dass Ernährung sowohl lokal als auch über systemische Prozesse einen Einfluss auf die Entzündung und das Mikrobiom ausübt [40]. Auf der lokalen Ebene konnte gezeigt werden, dass Zucker vom oralen Mikrobiom zu entzündungsfördernden Carboxylsäuren metabolisiert wird, die eine gingivale Entzündung auslösen können [16]. Diesbezüglich ist wichtig, dass auch der Kauaufwand betrachtet wird, da Kauen wesentlich zum Speichelfluss beiträgt [26,40]. Faser- und ballaststoffhaltige Lebensmittel erfordern in der Regel einen höheren Kauaufwand. Neben einem Sättigungseffekt, der durch Kauen ausgelöst wird, spült der geförderte Speichel Zucker schneller von den Zähnen.
Ein weiterer lokaler Effekt von Ernährung besteht in der Modulation der Quantität des Biofilms. So konnte gezeigt werden, dass beispielsweise grüner Tee durch enthaltene Polyphenole eine biofilmhemmende Wirkung hat, die sogar mit Chlorhexidin-Spülungen vergleichbar ist [7]. Diese Wirkung scheint übertragbar auf andere polyphenolhaltige Lebensmittel, wie Kurkuma. Zucker und prozessierte Kohlenhydrate hingegen fördern die Biofilmakkumulation [31].
Systemische Wirkungen von Ernährung auf das Parodont
Kohlenhydrate
Auf der systemischen Ebene vollzieht sich eine Vielzahl von Effekten durch Ernährung. Prozessierte Kohlenhydrate gehen mit starken Blutzuckerschwankungen und postprandialen Entzündungsreaktionen einher [41] (Abb. 1). Während der Glukoseanteil im Zucker für die Blutzuckerschwankungen verantwortlich ist, wird der Fruktoseanteil insulinunabhängig unter anderem zu LDL-Cholesterin verstoffwechselt [41].
Dabei spielt der „fehlende“ Ballaststoffanteil – der im Ursprungsprodukt, der Zuckerrübe oder dem Zuckerrohr, noch vorhanden war – eine große Rolle: Die in Naturprodukten enthaltenen Ballaststoffe wirken dem Blutzuckeranstieg entgegen, senken das Cholesterin und haben einen antientzündlichen Effekt [28]. Zudem sind Ballaststoffe die zentralen Sättigungsstoffe, die einem Überkonsum von Zucker natürlich entgegenwirken [13].
 pixabay
pixabayDabei spielt der „fehlende“ Ballaststoffanteil (der ja im Ursprungsprodukt, der Zuckerrübe oder dem Zuckerrohr, noch vorhanden war) eine große Rolle: Die in Naturprodukten enthaltenen Ballaststoffe wirken dem Blutzuckeranstieg entgegen, senken das Cholesterin und haben einen antientzündlichen Effekt [23]. Wird Zucker nun regelmäßig in größeren Mengen (> 25 g/d) konsumiert, was in der Regel der Fall ist, kann dies u.a. zu Karies, Gingivitis, Parodontitis, Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, nichtalkoholischer Fettleber und Hypercholesterinämie führen [5,10,24,33].Wird Zucker nun regelmäßig in größeren Mengen (> 25 g/d) konsumiert, was in der Regel der Fall ist, kann dies unter anderem zu Karies, Gingivitis, Parodontitis, Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, nichtalkoholischer Fettleber und Hypercholesterinämie führen [6,11,29,40].
Der positive Effekt einer Zuckerreduktion auf Gingivitis wurde in einer aktuellen Übersichtsarbeit von Interventionsstudien nachgewiesen [38]. Der Zusammenhang von Zuckerkonsum und Parodontitis ist auf Assoziationsebene nachgewiesen [18]. Eine kürzlich durchgeführte interventionelle Studie konnte zudem zeigen, dass Parodontitispatientinnen und -patienten im Rahmen der Parodontitistherapie durch eine Zuckervermeidung auch das Bluten auf Sondieren und Resttaschen noch stärker verringern können verglichen mit einer Parodontitistherapie ohne Zuckervermeidung [22].
Dabei spielt der „fehlende“ Ballaststoffanteil (der ja im Ursprungsprodukt, der Zuckerrübe oder dem Zuckerrohr, noch vorhanden war) eine große Rolle: Die in Naturprodukten enthaltenen Ballaststoffe wirken dem Blutzuckeranstieg entgegen, senken das Cholesterin und haben einen antientzündlichen Effekt [23]. Wird Zucker nun regelmäßig in größeren Mengen (> 25 g/d) konsumiert, was in der Regel der Fall ist, kann dies u.a. zu Karies, Gingivitis, Parodontitis, Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, nichtalkoholischer Fettleber und Hypercholesterinämie führen [5,10,24,33].
In Anbetracht der wissenschaftlichen Nachweise für die Schäden, die der Zuckerkonsum hervorruft, stellt sich die Frage, warum der Homo sapiens diesen Stoff in Reinform überhaupt noch konsumiert. Die Antwort ist nach Ansicht des Autors sowohl in der dopaminausschüttenden Wirkung von Zucker als auch in der gesellschaftlichen und kulturellen Verbreitung sowie der industriellen Bewerbung des Zuckerkonsums zu sehen [1,34].
Die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Handelns wird durch den durchschnittlichen Zuckerkonsum in Industrienationen deutlich: Während dieser vor der industriellen Revolution noch weit unter dem WHO-Grenzwert lag, ist er seit 1850 stark angestiegen und beträgt heutzutage ca. 30 bis 40 Kilogramm/Kopf/Jahr [15]. Verhältnispräventive Maßnahmen wie eine Zuckersteuer konnten in Ländern wie Großbritannien eine bemerkenswerte Reduktion des Zuckerkonsum bewirken, was in Deutschland mit der Strategie einer „freiwilligen Reduktionsstrategie der Industrie“ nicht funktioniert hat [24].
Fette
Ein weiterer Makronährstoff, dessen Konsum sich seit der Jäger-Sammler-Zeit stark verändert hat, sind Fette: Der Konsum von Omega-3-Fettsäuren (O3FS) ist im Verhältnis zum Konsum von Omega-6-Fettsäuren (O6FS) in den Hintergrund getreten [25]. Während zu Jäger-Sammler-Zeiten ein Verhältnis von 1:1 angenommen wird, beträgt es heutzutage über 1:20 (O3FS:O6FS). Während den O3FS eine entzündungshemmende und -auflösende Wirkung zugeschrieben wird, sind O6FS kompetitive Gegenspieler und eher mit proinflammatorische Prozessen assoziiert [5].
O6FS kommen vor allem in Getreide und Fleisch (Arachidonsäure) vor, während O3FS vor allem in Landpflanzen wie Raps, Walnüssen, Leinsamen, Chiasamen und in aquatischen Formen, etwa in Algen und Seefischen, vorhanden sind. Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die aktiven (entzündungsreduzierenden) Formen der O3FS (EPA/DHA) aus den Landpflanzen im menschlichen Körper nur ungenügend synthetisiert werden können. Daher ist eine Zufuhr von aquatischen O3FS notwendig – ob nun über Algenöl oder Fisch. Der parodontal-gesundheitliche Vorteil einer suffizienten Versorgung mit EPA/DHA konnte insbesondere für die Supplementation adjunktiv zur Parodontitistherapie gezeigt werden [17,30], aber auch auf Populationsebene und zur Prävention/Therapie der Gingivitis [2,21,36,37].
Tierische und pflanzliche Proteine
Da vegetarische und vegane Ernährungsweisen hierzulande eine zunehmende Akzeptanz und Beliebtheit erfahren, ist die Frage nach einer geeigneten Proteinzufuhr von großem öffentlichem Interesse. Bezüglich der parodontalen Gesundheit zeichnet sich ein Vorteil von fleischarmen, vegetarischen Ernährungsweisen ab [9,19,27] (Abb. 2), in Abhängigkeit unter anderem davon, ob die vegetarische Ernährungsweise vollwertig gestaltet wird (z.B. Vollkorn statt Weißmehl, Obst statt Saft) und ob kritische Nährstoffe, wie z.B. Vitamin B12, supplementiert werden [19,40,42].
 pixabay
pixabayIn jedem Fall lohnt es sich, den Fleischkonsum unter 300 g pro Woche zu reduzieren. Ein gesundheitlicher Nutzen ist dann erwartbar – neben positiven Effekten für die Umwelt und für das Tierwohl sowie auch hinsichtlich der Antibiotikaresistenzen [33].
Mikronährstoffe
Einer der größten Betrachtungsbereiche für Gingivitis und Parodontitis betrifft die Mikronährstoffe. Subsumiert lässt sich sagen, dass für so gut wie alle Mikronährstoffe eine Unterversorgung mit einem erhöhten Risiko für parodontale Entzündungen einhergeht [8,40]. Besonders prominent ist hier die Diskussion um Vitamin D, Vitamin C und weitere antioxidative Vitamine.
Bis auf Vitamin D können diese Mikronährstoffe prinzipiell suffizient mit der Nahrung aufgenommen werden. Im Fall von Vitamin D kann eine Testung und Supplementation vor allem bei bestimmten Patientengruppen (keine Tätigkeit im Freien, Über-60-Jährige, Menschen mit dunkler Hautfarbe, Übergewichtige, Nachtschichtarbeiter und v.a.) im Winter sinnvoll sein. In einer Studie, die Vitamin-D-Gaben adjunktiv zur Parodontitistherapie untersuchte, profitierten jedoch lediglich die Patienten mit Werten unter 30 ng/ml [23].
Eine aktuelle Literaturübersicht konnte zeigen, dass adjunktiv zur Parodontitistherapie Vitamin-E-reiche Lebensmittel, Chicorée-Extrakt, mikronährstoffreiches Beerenpulver, grüner und Oolong-Tee signifikante Vorteile in der Therapie brachten im Vergleich zur rein mechanischen Therapie [39]. Für den Konsum von 500 g Blaubeeren täglich für eine Woche konnte sogar eine Gingivitisreduktion vergleichlich einer professionellen Zahnreinigung gezeigt werden [32].
Sekundäre Pflanzenstoffe, pflanzliche Nitrate
Neben den Mikronährstoffen weisen sekundäre Pflanzenstoffe, zu denen unter anderem die Polyphenole gehören, und pflanzliche Nitrate wichtige Funktionen auf. Im Rahmen der „Würzburger Salatsaftstudie“ konnte für die pflanzlichen Nitrate eine eindrucksvolle Wirkung gegen Gingivitis gezeigt werden [14]. Während die Kontrollgruppe, die für 14 Tage einen Salatsaft ohne Nitrate zu sich nahm, keine Veränderung der Gingivitis zeigte, ging die Gingivitis in der Experimentalgruppe mit Nitrat deutlich zurück.
Der Wirkmechanismus dabei ist hochinteressant [20]: Es wird angenommen, dass sich das aufgenommene Nitrat in den großen Speicheldrüsen akkumuliert, dort wieder mit dem Speichel ausgeschüttet wird, um dann von nitratreduzierenden Bakterien zu Nitrit verstoffwechselt zu werden. Das Nitrit zerfällt in der sauren Umgebung des Magens zu Stickstoffmonoxid (NO), welches wiederum eine blutdrucksenkende und antientzündliche Funktion aufweist. Zudem wurden auch lokale Effekte von Nitrat auf kariogene Biofilmbakterien gefunden [10].
Fazit und praktische Hinweise zur Ernährungsberatung
In der praktischen Beratung von zahnärztlichen Patientinnen und Patienten kann es sowohl sinnvoll sein, einzelne kritische Nährstoffe in unterschiedlichen Sitzungen zu thematisieren, wie Zucker oder Vitamin D, als auch eine umfassende Beratung durchzuführen. Dieses unterschiedliche Vorgehen hängt nicht zuletzt von dem Praxiskonzept und der für dieses Thema reservierten Zeit ab.
Im Sinne einer zusammenfassenden Empfehlung kann den Patientinnen und Patienten eine hauptsächlich pflanzenbasierte Vollwertkost mit zusätzlichem Fokus auf Vitamin D, EPA/DHA und eventuell Vitamin B12 empfohlen werden. Falls Patientinnen und Patienten dabei eine vegetarische oder vegane Ausrichtung vollziehen, sollte dies auf jeden Fall mit einer Vitamin-B12- und EPA/DHA-Supplementation begleitet werden. Eine Vollwertkost bedeutet dabei, statt der prozessierten die vollwertige Variante zu wählen, z.B. Vollkorn statt Weißmehl, Obst statt Zucker oder Saft.
Für eine Zuckerreduktion oder -entwöhnung kann sich als teilweiser Ersatz die Verwendung von Trockenfrüchten, Xylitol, Erythritol oder Stevia eignen. Von ballaststofffreien Glukose-/Fruktose-Süßern sollte abgeraten werden. Dazu zählen etwa Honig, Agavendicksaft oder Kokosblütenzucker. Ein wichtiger Punkt, der in der Patientenberatung zusätzlich motivieren kann und daher erwähnt werden sollte: Durch eine entsprechende Ernährungsumstellung profitiert nicht nur die Mundgesundheit, sondern auch die allgemeine Gesundheit.
Am Beispiel des Übergewichts: In drei Interventionsstudien konnte über 4 Wochen nicht nur eine Gingivitisreduktion, sondern auch eine Gewichtsreduktion von 1,5 bis 3 Kilogramm erzielt werden, ohne dass die Patientinnen und Patienten hungern mussten [2,3,37]. Dieser Effekt hätte durch eine reine Förderung der Mundhygiene nicht stattgefunden.
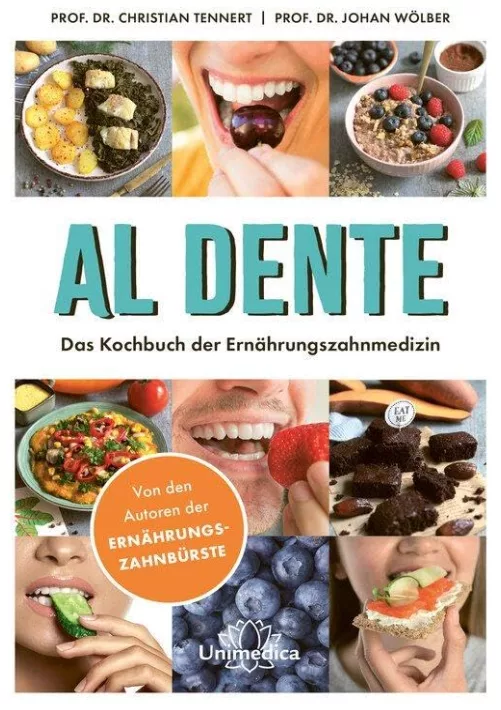 Wölber
WölberLeckere, alltagstaugliche Rezepte für eine zahngesunde Ernährung haben Professor Dr. Johan Wölber und Prof. Dr. Christian Tennert in Ihrem neu erschienenen Kochbuch „Al Dente – Das Kochbuch der Ernährungszahnmedizin“ zusammengestellt. Erschienen 2025 im Unimedica Verlag, ISBN 978-3962573546, 216 Seiten, Preis: 22,90 Euro (gebunden) bzw. 20,60 Euro (Kindle-Version).
 Entdecke CME Artikel
Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download
Entdecke Artikel mit Download 




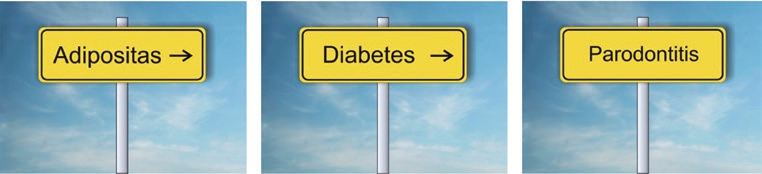

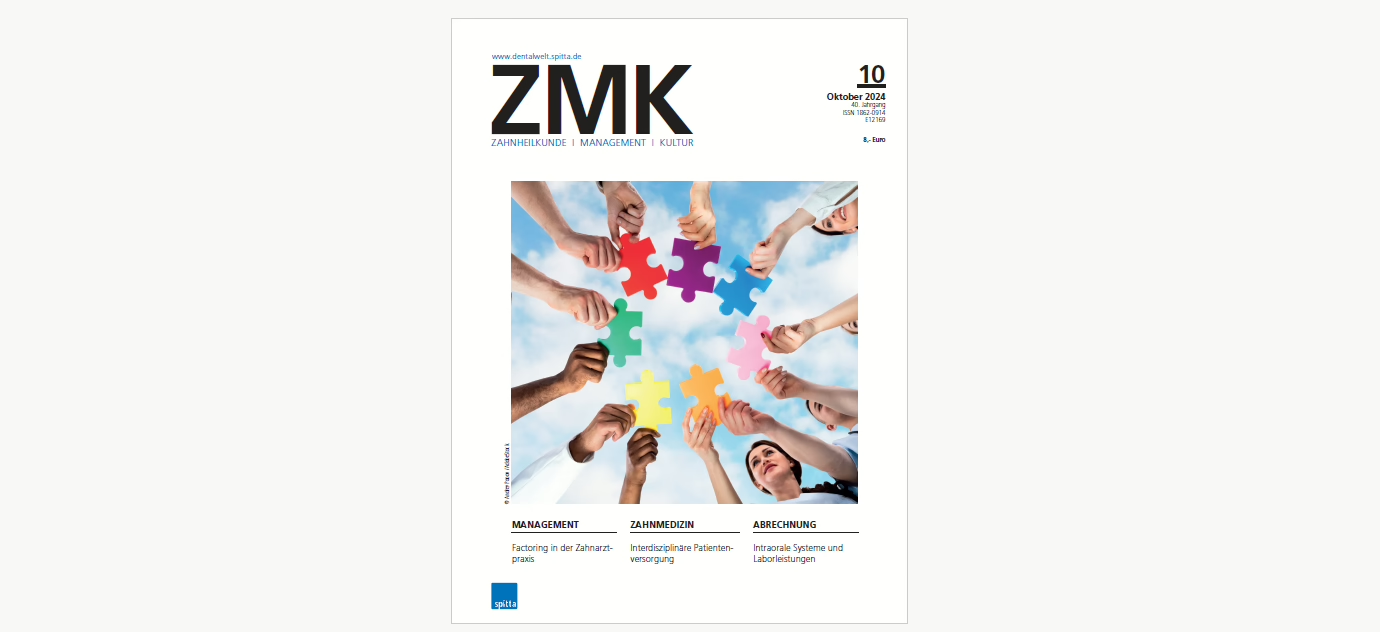
 Mit Google einloggen
Mit Google einloggen
 Mit Facebook einloggen
Mit Facebook einloggen
Keine Kommentare.